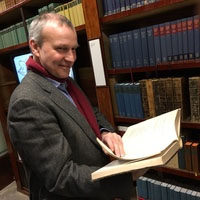Thomas Buchheim (geb. 1957) promovierte 1984 bei Robert Spaemann an der Universität München und habilitierte sich dort 1991 in Philosophie. Er wurde 1993 Professor in Mainz und war von 2000 bis 2023 Ordinarius für Metaphysik und Ontologie an der Ludwig-Maximilians-Universität.
Von 2006 bis 2023 war er Herausgeber des Philosophischen Jahrbuchs. Er ist Mitglied der Kommission zur Herausgabe der Schriften Schellings der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und war von 2010 bis 2013 Vorsitzender der Gesellschaft für antike Philosophie. 2013 war er Inhaber der Gastprofessur an der Graduate School of Human and Environmental Studies der Staatlichen Universität Kyoto. Seit 2022 leitet Buchheim das von der DFG geförderte Projekt des unvollendeten Systems der Spätphilosophie Schellings.
„Für mich ist Philosophie die Freude an der Suche nach Gründen.“ Gespräch mit Thomas Buchheim
Widerspruch: Herr Buchheim. Wie sind Sie zur Philosophie gekommen, und warum haben Sie sich entschieden, Philosoph zu werden?
Buchheim: Ich habe mir bereits in jungen Jahren Überlegungen über „philosophisch“ genannte Fragen gemacht, etwa derart, was es bedeutet, Bewusstsein zu haben und nicht nur tot herumzuliegen; in der Schule wußte ich schon, dass ich „Philosoph“ werden wollte. Ich hatte dann eine Phase, in der ich gerne Koch werden wollte, und dachte, man könne das kombinieren: erst einen praktischen Beruf erlernen und dann Philosoph werden, so dass man einen Boden unter den Füßen hat. Ich habe das dann doch nicht gemacht, weil ich die Zeit bei der Bundeswehr als völlig absurd empfand und gierig nach geistiger Beschäftigung war. Ich erinnere mich, dass ich mich dort in den Keller zurückgezogen und einfach geschrieben habe, nur um die grauen Zellen während dieser langweiligen Phase etwas auf Trab zu halten. Danach hatte ich die Nase einfach voll und dachte: sofort oder nie. Mein Schreiben war weniger literarisch und mehr mit Gedankengängen befasst. Eine der Fragen, die mich oft beschäftigt haben, war, wie das Wollen funktioniert, ob das, was man will, nicht davon abhängt, welche Argumente für welche Seite sprechen. Ich dachte, dass man das eigentlich immer weiter treiben kann. Es lässt sich auf jeder Seite noch etwas „draufsetzen“, auf der einen Seite und dann wieder auf der anderen, damit sie nicht zu kurz kommt. Wie kommt man überhaupt dazu, von mehreren Möglichkeiten eine zu wollen? Das ist ein Beispiel für die Art meiner Überlegungen.
Nach der Bundeswehr habe ich mich umgehört, wo man in Deutschland Philosophie studieren kann, und bekam gesagt, dass München besonders interessant sei. Das Institut war damals noch um einiges größer als jetzt, wo es ja immer noch eins der größten Institute in Deutschland ist. Und – es waren berühmte Leute da. Ich fand es unheimlich fesselnd; es war ein Sturz nicht nur in die studentische Freiheit, sondern eben auch in die Freiheit der Philosophie. Es war immer mein Gedanke, dass man als Philosoph über alles nachdenken kann. Man ist nicht sachlich so gebunden, dass man dann irgendwann Experte ist und sich langweilt, weil man das, was die Leute von einem erwarten, immer noch weitertreiben muss. Im Studium war ich also praktisch völlig mir selber überlassen und konnte im Grunde allem eine interessante Perspektive abgewinnen. Es zählten nur die eigenen Ansprüche und nicht die, die einem vorgesetzt wurden. Damals war die Stimmung eine andere als heute. Diese Tendenz zur Desorientierung in der Philosophie galt als erstrebenswert und wurde oft gelobt. Wer heute Philosophie studiert, erwartet etwas anderes. Und man muss sich auf diese Änderungen einstellen.
Widerspruch: Heute sind ja vielfältige Bestrebungen im Gange, das Philosophiestudium zunehmend zu reglementieren. Ich denke an die Einführung von Höchststudienzeiten oder an das neue Projekt des M.phil.-Abschlusses. Wie stehen Sie zu diesen Bestrebungen?
Buchheim: Die Sache hat zwei Wurzeln. Die von außen, die für den Akademiker unschön ist, weil sie an ihn einfach herangetragen wird: die Knappheit der finanziellen Mittel und die Fragen der Gesellschaft, wozu du eigentlich gut bist, wenn du an der Universität bist. Hinzu kommt der Gedanke des Wettbewerbs, des nationalen und internationalen Vergleichs, in dem man sich behaupten muß. Da geht es nicht an, dass eine Universität sich dem verschließt. – Die andere Wurzel, die man nicht unterschätzen darf, und weswegen ich auch bereit bin, Kompromisse zu schließen, ist die eigene „Klientel“. Heute wollen die Studenten überwiegend einen gewissen Grundstock erhalten und am Anfang erst einmal gesagt bekommen, was eigentlich wichtig ist, – und erst dann, wenn das einigermaßen gelernt ist, in die „philosophische Autonomie“ überwechseln. Das hat ja eine Vernunft für sich. Man will die philosophische Autonomie nicht sofort, weil das nicht Autonomie, sondern das Chaos wäre. Auch wenn man natürlich einwenden kann, dass das Chaos auch wichtig ist, ein produktives Chaos. Doch wenn die eigene Klientel nach einem solchen Grundstock verlangt, dann, meine ich, muss man dem auch Rechnung tragen.
Widerspruch: Wenn man jedoch sieht, dass beim Ausbildungsgang zum M.phil. nur sechs Bewerber dabei geblieben sind, gibt das doch zu der Frage Anlass, ob die Nachfrage nach einem so stark reglementierten Studium wirklich so groß ist.
Buchheim: Gut. Es sind ja auch bloß zwölf Studienplätze insgesamt für den M.phil.; 50% sind also noch dabei. Es ist doch oft so, dass in der Anfangsphase des Studiums noch vieles wackelt. Vielleicht sind es auch die Anfangsschwierigkeiten, weil dieser Studiengang noch nicht genug publik ist und er auch noch nicht die rechte Balance gefunden hat und man in eine gewisse Richtung überzieht. Was ich vorher sagte, gilt jedoch für alle Studienmöglichkeiten der Philosophie: sie alle sollen ein größeres Maß an Orientierung und Verschulung bieten. Der M.phil. verbindet den Akzent in diese Richtung zugleich mit dem höheren Anspruch, die intrikaten Probleme, vor allem der analytischen Gegenwartsphilosophie, kompetent zu vermitteln. Man soll dann auch mitreden können; man soll nicht nur passiv Aufsätze lesen, sondern am Ende des Studiengangs an dieser Diskussion auch teilnehmen, also publizieren. Und da man das richtig trainieren muss, ist das Studium durchaus mit einem Denksport zu vergleichen, was mir übrigens, wie ich eingangs sagte, als eine sehr reizvolle Sache erscheint. Dieser Studiengang geht betont in eine solche Richtung, saubere methodische Gedankengänge im Sinne der analytischen Philosophie selbst zu machen.
Widerspruch: Steht nicht doch das Bestreben dahinter, die Philosophiestudenten für die außerakademische Sphäre zu qualifizieren? Und bedeutet das nicht, das traditionelle Konzept, die Philosophie sei Selbstzweck, zu verabschieden? Habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dann muss dies auch für Sie den Nachteil haben, dass die philosophische Freiheit, in der Sie ja das Eigentümliche der Philosophie sehen, sehr stark eingeschränkt wird.
Buchheim: Das gehört in der Tat zu den großen Änderungen. Denn die Philosophie war im Kern, von der ganzen Tradition und vom Selbstverständnis her, rein akademisch. Platon hatte die Akademie außerhalb Athens gegründet, außerhalb des politischen Tagesgeschäfts. Sie grenzte sich bewusst von dieser Berufsdominiertheit des Lebens ab. Heute aber muss sich die Philosophie, um Studenten in genügender Zahl zu behalten, um andere Berufsabschlüsse bemühen. Es ist eben ein doppelt gewurzelter Anspruch, der an sie herangetragen wird: von der Klientel und von außen; und dem muss man sich stellen. – Anders als Sie bin ich jedoch der Meinung, dass die sonstigen Studiengänge, wie der normale Magister, viel eher geeignet sind, um außerhalb der Philosophie unterzukommen. Das sind dann „Leute mit Horizont“, die noch etwas ganz anderes gemacht haben. Sie können auf der einen Seite dieses Andere mit philosophischen Mitteln betrachten; und sie können andererseits aus diesem Anderen auch Anregungen beziehen für das, was sie philosophisch behandeln. In sehr vielen Berufssparten braucht man solche Leute, die mit Fremdem umgehen können, es sich schnell erschließen können, und die vielleicht ein paar Verfahren an der Hand haben, um auch solche Sachen gut zu machen, wo es noch keine völlig gebahnten Wege gibt. Der M.phil. scheint mir jedoch ein Studiengang zu sein, der ganz darauf abhebt, akademischen Nachwuchs zu produzieren. Also, wenn man es ehrlich ausspricht – und ich weiß nicht, ob die Selbstdarstellung des M.phil. im Moment so ehrlich ist –, dann ist er der Regenerationsstudiengang für das Fach Philosophie; denn hier werden Ansprüche gestellt, die doch ziemlich streng sind. Man wird dann unter Umständen den Studienmodus wechseln müssen, was man ja jederzeit kann. Diese Durchlässigkeit finde ich gut. Zwar werden im Moment auf dem umgekehrten Weg vom Magisterstudiengang in den M.phil. noch recht hohe Hürden gesetzt, weil es bisher nur einen Einstiegspunkt im Laufe des Studiengangs gibt. Aber ich werbe dafür, dass man die Durchlässigkeit größer macht. „Wettbewerb“ ist gut und schön; aber man sollte diese Gänge auch nicht zu weit voneinander entfernen, so dass unter Studenten die Stimmung aufkommt, es gebe zwei Klassen. Ich würde also lieber sagen: es sind zwei verschiedene Typen, sich der Philosophie zu nähern, die für ebenso verschiedene Lerntypen geeignet sind. Das Spezifikum des M.phil. scheint mir aber in der Tendenz zu liegen, den akademischen Nachwuchs nach heutigen Standards des Faches reproduzieren zu wollen. Diese werden dann einen sehr engen und heiß umkämpften Markt vorfinden, für den sie viel können müssen, und auf dem sie sich im Vergleich mit den wirklich guten Auslandsuniversitäten durchbeißen müssen, die ja im undergraduate-Bereich viel verschulter sind als hier. Wenn man da für seine eigenen Absolventen überhaupt noch Chancen sehen möchte, dann muss man dafür ein Äquivalent schaffen. Dabei muss man natürlich immer im Auge behalten, dass heutige Standards nicht unbedingt auch die Standards von morgen sind. Die Philosophie bleibt frei.
Widerspruch: Aber damit wird sich die Dominanz der analytischen Philosophie in Deutschland verstärken, die in ihren Ursprungsländern, den angloamerikanischen Ländern, eher etwas an Boden zu verlieren scheint, weil zu wenig Inhalte behandelt werden. Droht nicht damit die klassisch europäisch-kontinentale Philosophie weiter zurückgedrängt zu werden?
Buchheim: Das ist eine Gefahr. In den USA und in England ist der Erwerb der analytischen Fertigkeiten auf jeden Fall die Grundausbildung. Sie ist im ersten Schritt des Studiums entscheidend. Dann aber sind Sie in den USA nicht so gut dran wie bei uns, wo die Pflege der traditionellen Philosophie größer ist. Ich denke, man muss die Sachen eben so miteinander kombinieren, dass man sagt: am Anfang ist die Dominanz der analytischen Fähigkeit nicht schlecht; sie soll aber nicht so betrieben werden, dass die Studenten nichts anderes mehr zur Kenntnis nehmen. Dafür ist entscheidend, wer den Studiengang macht, d.h. die Lehrveranstaltungen abhält. Sind das Leute, die die Analyse zwar auch beherrschen, die aber auch einen allgemeinphilosophischen Horizont haben, oder sind das Leute, die nur diesen Stiefel kennen? Durch eine Einlinigkeit würde diese an sich gute Idee zerstört. Ich verspreche mir schon etwas, wenn seitens des Lehrpersonals Anstrengungen gemacht werden, so dass wir in einigen Jahren sehen können, ob man nicht damit Boden gut gemacht hat. Die Gefahren, die Sie genannt haben, sind da. Aber man muss sie durch die Art und Weise, wie man es macht, möglichst klein halten.
Widerspruch: Die Bestrebungen, in Deutschland immer mehr angloamerikanische Strukturen zu übernehmen, zeigen sich auch in der vor kurzem eingeführten Aufteilung in Departments. Kürzlich war ein Wissenschaftler nach München zu einem Vortrag eingeladen, der nicht kam und in einem offenen Brief an Rektor Heldrich von „albernen Anglizismen“ sprach. Was soll man sich unter einer solchen Einteilung in Departments vorstellen und was sind ihre Auswirkungen und ihre Bedeutung?
Buchheim: Erstmal hat es für mich etwas Komisches, weil es bloß ein anderer Name, ein anderes Wort ist für eine Struktur, die dem sehr verwandt ist, was wir bereits kennen. Ich war vorher in Mainz, und dort hieß es ”Philosophisches Seminar” und gleicht nach allem, was ich weiß, der Struktur des „Departments“, das hier jetzt in Kraft ist, wie ein Ei dem anderen. Wir haben in Mainz bereits Mittel des Faches in der Weise zentral verwaltet, wie das hier jetzt im Department sein soll. Die hauptsächliche Änderung besteht darin, dass bisher der einzelne Lehrstuhl die Mittel verwaltete und jetzt das Department, das die Mittel nach seinen Plänen für das Ganze verteilt. Jetzt können auch andere Professoren als nur die Lehrstuhlinhaber und sogar Assistenten und Mitarbeiter, wenn sie fürs Department interessante Dinge machen, direkt partizipieren, was bisher nur über den Lehrstuhlinhaber, dem sie „anvertraut“ waren, möglich war. Schlimm wäre es freilich, wenn sich jetzt bei der Mittelverteilung Animositäten geltend machen, dass man also übereinander herfällt. Unser Fach, das sowieso in der Universität vergleichsweise schwach da steht, würde sich selbst zerstören. Es wäre schön, wenn man einen Kooperationsgeist entwickelte, wenn die verschiedenen Lager, Logik und Wissenschaftstheorie auf der einen Seite, die klassische, traditionelle Philosophieauffassung auf der anderen Seite, und auch die Religionsphilosophie bzw. -wissenschaft zu einer Einheit würden. Für mich ist das große Vorbild die klassische Philologie. Dieses Fach steht seitens der Öffentlichkeit noch mehr unter Druck als die Philosophie; es ersetzt ihn aber ganz geschickt durch ein hohes Maß an korporativer Identität und bildet quasi eine „verschworene Gemeinschaft“. Das ist vielleicht übertrieben; aber ein bisschen was davon könnte sich die Philosophie abschneiden, auch wenn es bei den Philosophen wohl etwas schwieriger ist, weil die Differenzen immer gleich ins Existentielle zu lappen drohen.
Widerspruch: Ihr Vorgänger in München, Werner Beierwaltes, hat seinen Lehrstuhl, der für „Geschichte der Philosophie“ ausgeschrieben war, sehr historisch betrieben. Wollen Sie ihn in diesem Geist weiterbetreiben oder möchten Sie eher systematisch Ontologie betreiben? Was sind Ihre Pläne und Ziele?
Buchheim: Zunächst ist die Definition des Lehrstuhls gleich geblieben. Er heißt aber nicht, wie Sie sagen, „Geschichte der Philosophie“, sondern „Metaphysik und Ontologie“ mit Schwerpunkt auf der antiken Philosophie und der Philosophie des Mittelalters. Nun hat mein Vorgänger in der Tat den zweiten Teil dieser Beschreibung besonders ernst genommen, während für mich eher umgekehrt die systematische Ausrichtung auf Metaphysik und Ontologie – was Zweierlei ist – den Schwerpunkt bildet. So ist z.B. der Freiheitsbegriff, mit dem ich mich viel beschäftige, ein metaphysisches Thema, aber nicht ohne weiteres und unter allen Gesichtspunkten auch ein ontologisches Thema. Mir ist also die systematische Widmung „Metaphysik und Ontologie“ besonders wichtig, und ich identifiziere das nicht mit Geschichte der Philosophie bis einschließlich Mittelalter. Meine Zuwendung zur und Begeisterung für die alte, besonders die antike Philosophie hat eher einen methodischen Grund: Denn ich verwende frühere Gedankenentwürfe, die ich für gut halte, besonders von Aristoteles und Leibniz, zum Vorbild für eigenes, d.h. durchaus aktuelle Interessen hegendes Denken im systematischen Sinne. „Vorbild“ heißt, dass ich sie nicht als Ganzes nehme, sozusagen als Weltanschauung, sondern mir einzelne Stücke, besondere „Juwelen“ an Genauigkeit und Überzeugungskraft, heraussuche und mich mit ihnen vor dem, was ich eine gegenwärtige, eine zeitgenössisch belehrte Vernunft nenne, zu verantworten suche. Ich lasse mich also vor der heutigen Vernunft zur Verantwortung ziehen für Gedanken, die ich bei Aristoteles oder Platon finde, aber auch bei Leibniz, Kant oder Schelling, mit denen ich mich viel befasst habe. Und ich glaube, dass man in seinem eigenen Denken dann systematisch weiterkommt, wenn man diese herausgelösten Stücke unter dem Licht einer heutigen Vernünftigkeit erneut benutzt und zu rechtfertigen versucht, – vielleicht mit anderen Argumenten, als diese Philosophen selbst verwendet haben. Dieses Verfahren führt meines Erachtens weiter, als wenn man sagt: „gestern war gestern, und heute ist heute“. Unsere ganze Sprache und Kultur sind ja nicht unabhängige Sachen, die einfach so sind, wie sie sind, wie das Planetensystem oder die Teilchen, sondern sind als Elemente unserer eigenen intellektuellen Existenz historisch geformt und damit auch geschichtsbelastet. Deswegen müssen wir die Stücke der Geschichte, die dazu beigetragen haben, dass unsere intellektuelle Verfassung so ist, wie sie ist, würdigen und sie neu durchdenken.
Widerspruch: Konkretisieren wir das: Aristoteles denkt teleologisch; er nimmt eine Zwecktätigkeit in der Natur an. Die heutigen empirischen Wissenschaften, etwa die Biologie, sprechen von Zweckmäßigkeit: die Lunge z.B. ist zweckmäßig für die Luft, die sie atmet. Wie bekommt man das zusammen oder wie ließe sich das heute aktualisieren und vereinbaren?
Buchheim: Dieser Unterschied ist sicherlich ein besonders empfindlicher Punkt. Er gehört aber zu denen, die ich an Aristoteles für wichtig halte und die man nicht einfach aufgeben sollte. Man muss eben zwei Bedeutungen von „Zwecktätigkeit“ unterscheiden, wie Sie das in gewisser Weise schon gemacht haben, wenn Sie Zweckmäßigkeit von Zwecktätigkeit unterscheiden. Einmal das, was im Zeichen einer Absicht, mit einem Ziel getan wird; einmal das, was ohne eine solche Absicht geschieht. Es ist eine Unterstellung der Philosophie und der Naturwissenschaften der Neuzeit, dass die frühere, wenn von Zielen die Rede war, immer eine solche leitende Absicht im Spiel gesehen habe. Aber so war es nicht gedacht, bei Aristoteles ganz gewiss nicht; vielleicht später mal dann im antik-christlichen Bereich. Bei Aristoteles ist keine leitende Absicht im Spiel, sondern der Zweckbegriff bedeutet soviel wie Vollendung. Und der Unterschied, den er macht, ist der, dass manchmal der Bewegungsverlauf so ist, dass ständig sich anderes an anderes reiht, also eine sozusagen sich selbst differenzierende Bewegung, die woanders beginnt als sie endet. Das ist die nichtvollendete Form von Bewegung. Dann aber gibt es die Vollendungsform von Bewegung, wo die Bewegung in sich selbst zurückkehrt und sich selbst wieder in Gang setzt. Das war es, was Aristoteles einen „Naturzweck“ nannte. Wenn ein Embryo sich entwickelt, dann differenziert er sich; aber diese Differenzierung führt zu einem Punkt, in dem sie nicht mehr weitergeht, sondern die Lebenstätigkeit nur noch von der erreichten Gestalt des Organismus initiiert wird und diese Gestalt erhält. Das nennt Aristoteles Entelechie, das „im Ziele sein” einer Sache. Dieses Element der Beschreibung eines Organismus in seiner vollendeten Tätigkeit kann man in gewisser Weise eine Zwecktätigkeit nennen, ein Element, das unter anderem Namen übrigens auch in der Neuzeit sehr prominent gewesen ist: nämlich Selbsterhaltung, nur hat der Gedanke der „Vollendung“ auch noch den Beiklang des Gelungenen und der selbstrelativen Steigerung. Auch bei Aristoteles wird die vollendete Tätigkeit unter dem Gesichtspunkt des Guten gedacht, dass es also gut oder vorteilhaft – Vollendung sagt ja das gleiche – für einen Organismus ist, in diesem Zustand zu sein. Bei ihm hat es etwas Normatives, während die Selbsterhaltung in der Neuzeit eine völlige Beliebigkeit hat: alles versucht, sich selbst zu erhalten; es wird nichts mehr ausgezeichnet.
Dagegen würde ich festhalten an dem Prädikat „gut“. Und die neuere Evolutionsbiologie gibt dieser Ansicht wenigstens in einigen Punkten Recht. Die Organismen in der Natur sind als ausgezeichnet in dem Sinn zu begreifen, dass hier tatsächlich so etwas wie „Gutsein“ realisiert wird. Manfred Eigen hat in einem Vortrag auf ganz abstraktem Niveau zu erklären versucht, wie sich in der Natur bevorzugte Niveaus ausbilden und das Vorteilhafte vom Nachteiligen objektiv unterscheidbar wird; wo das der Fall ist, haben wir eine Entwicklung von Leben. Auch die Evolutionsbiologie operiert also mit diesen Begriffen. Ich glaube, dass man mit dem Gedanken der Vollendung, der sich nicht mehr differenzierenden, sondern sich wiederholenden und dabei intensivierenden, steigernden Tätigkeit ein Element hat, das man aus Aristoteles sehr gut gewinnen kann und von ihm auch sehr gut erklärt bekommt. Ich würde ihn also nicht einfach über den Haufen werfen und sagen: das war einmal. Mit den nötigen Differenzierung ist es ein haltbarer Gedanke.
Widerspruch: Lässt sich heute wieder ein Bündnis der Naturphilosophie mit den empirischen Wissenschaften schließen? Seit Hegel und Schelling ist eine systematische Naturphilosophie ja gründlich in Verruf geraten. Sehen Sie da Möglichkeiten?
Buchheim: Ich sehe diese Chance, wenn man die Naturgegenstände, die die Wissenschaften betrachten, nicht unter Ausnehmung des Menschen auffasst. D.h. so, dass wir auf der einen Seite die rationale Betrachtungsweise des Menschen haben, die auf der anderen Seite auf objektive Natur angewendet wird, welche uns dann zeigt, was sie für uns – die so sie Betrachtenden – ist. Das ist eine Art von Naturwissenschaft, in der sich Philosophie nicht sehr lohnt. Sobald man aber auf die Idee kommt – und auf sie kommen heute immer mehr –, dass die rationalen Vermögen des Menschen in gewisser Weise innerhalb der Natur zustande gekommen sind – wenngleich natürlich das Element der sozialen Welt dazukommt, das sicherlich sehr wichtig für die Entwicklung der rationalen Fähigkeiten ist –, aber wenn man im Prinzip der Meinung ist, das auch das Rationale in gewisser Weise ein animal ist, also ein Tier und also etwas Natürliches, dann finde ich es sehr lohnend, Naturphilosophie mit den empirischen Wissenschaften wieder zu verbinden. Denn die Philosophie ist immer da, wo der Mensch in seiner Existenzweise in den Blick rückt. Sie hat immer einen reflektierenden, auf sich selbst bezogenen Seitenarm, während die Wissenschaft ganz vom Betrachter absieht und nur auf den sich darstellenden Gegenstand achtet. Wie gesagt, wenn man das, was betrachtet, mit in die Betrachtung einbezieht, dann ist auch die Philosophie, in diesem Sinne als Naturphilosophie, wieder am Platz.
Widerspruch: Abschließend noch eine Frage zu Aristoteles. Frede und Patzig vertreten die These, dass Aristoteles die Form immer schon als individuelle denkt. Halten Sie diese These für gut begründet und belegt?
Buchheim: Das ist eine sehr spezielle Frage, aber ich habe mich damit viel befasst. Die These ist besser als die Begründung, die Frede und Patzig dafür gegeben haben. Ich bin dieser Meinung, weil bei Aristoteles sehr deutlich wird, dass er die Form, als eine Substanz, mit der Seele identifiziert. Er sagt das an vielen Stellen, so dass man es gut belegen kann. Wenn jedes Lebewesen seine Seele hat, dann muss ja die Form etwas Individuelles sein. Damit stellt sich natürlich die Frage: Wie kann ein solches individuelles Formelement die Grundlage für allgemeine Definitionen abgeben? Die klassische Lehre war, dass das s, die Form, allgemein sein muss; und ich glaube, dass Aristoteles da eine ganz besonders intelligente Antwort gegeben hat. Frede und Patzig haben sie so nicht dargestellt und deshalb diese These – die ich im Prinzip für richtig halte – nicht so gut begründet. Nämlich: Aristoteles sagt, dass die Seele das Prinzip der Tätigkeiten ist, und dass diese Tätigkeiten, die ein Organismus tut, dafür verantwortlich sind, wie er beschaffen ist, so dass also ein individuelles Prinzip bewirkt, dass ein Organismus von der Art und Beschaffenheit ist, die er ist. Diese Tätigkeiten ähneln sich hinreichend bei den Organismen einer Art, weil sie ja über die Tätigkeit des Reproduktionsprozesses miteinander verbunden sind. Auf diese Weise kann man ihre Ähnlichkeit gut erklären: weil die einzelnen Organismen kraft ihres individuellen Prinzips in ähnlicher Weise tätig sind, sind sie auch ähnlich; und dass sie ähnlich tätig sind, liegt daran, dass sie in einem gemeinsamen Reproduktionsprozess stehen. Und so hat man alle Stücke beisammen: Man hat sowohl die Allgemeinheit der Art als auch die Individualität der Form begründet. Es ist eben ein Vorzug, wenn die Form individuell ist; denn wenn auf der einen Seite die Substanzen nach Aristoteles Einzeldinge sind, und er auf der anderen Seite aber sagt, das, was die Substanz zur Substanz macht, sei die Form, dann wäre es misslich, wenn die Form einfach ein Allgemeines wäre. Denn wie kann ein allgemeines Prädikat dafür verantwortlich zeichnen, dass etwas eine einzelne Substanz ist? Auf dem Umweg, den ich erklärt habe, kann man das recht gut einsehen.
Widerspruch: Herr Buchheim. Wir danken für das Gespräch.
Das Gespräch führte Manuel Knoll.