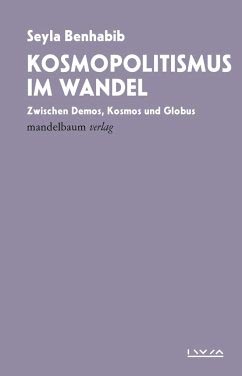Seyla Benhabib: Kosmopolitismus im Wandel. Zwischen Demos, Kosmos und Globus
br., 92 S., 13,– €, Mandelbaum Verlag, Berlin 2024
von Bernhard Schindlbeck
Mit bewundernswerter Ausdauer und Hartnäckigkeit hält Seyla Benhabib gegen alle von den gegenwärtigen Zeitläuften ausgesendeten Signale an ihrem Thema Kosmopolitismus fest, und das mit gutem Recht. Erinnert man sich an ihre vorangegangenen (auch auf Deutsch erschienenen) Publikationen wie Kosmopolitismus und Demokratie. Eine Debatte mit Jeremy Waldron, Bonnie Honig und Will Kymlicka (2006, dt. 2008) sowie Kosmopolitismus ohne Illusionen. Menschenrechte in unruhigen Zeiten (2010, dt. 2016) – dem unter Zeitknappheit leidenden Leser sei der Aufsatz Unterwegs zu einer kosmopolitischen Demokratie? in der Neuen Zürcher Zeitung vom 13.06.2009 empfohlen –, dann darf man mit Fug und Recht resümieren, dass Seyla Benhabib eines der für die kommende Praxis der Menschheit theoretisch wichtigsten Projekte verfolgt, dessen Bedeutung leider noch immer nicht ins Bewusstsein der maßgeblichen Regierenden und Institutionen auf dem Planeten gelangt ist. Eigentlich wissen alle, dass die globalen Krisen wie Klimawandel, Migration und Armut – und neuerdings ganz offensichtlich: die Konkurrenz von Imperialismen mit ihren Stellvertreterkriegen – nicht von den Regierungen auf nationaler Ebene, auch nicht durch internationale Kooperationen gelöst werden können, sondern nur in einem kosmopolitischen Gesamtrahmen. Gegen den aber sperren sich noch immer die meisten Regierungen, vor allem des westlichen Blocks, d.h. die Nachfahren der ehemaligen Kolonialherren.
Im Postskriptum ihres neuen Buches hält Benhabib fest, dass es während der Abfassung des Buches zum Terrorakt der Hamas vom Oktober 2023 kam, der nur dem Anschein nach den Proponenten einer rein machtorientierten „Realpolitik“ Recht gebe, jedoch kein Grund sei, das Beharren aufzugeben, „den latenten emanzipatorischen Gehalt unserer Ideale und Illusionen [mit denen sie sich auf die Frankfurter Schule bezieht – B. Sch.] sichtbar zu machen“ (78).
Das unzweifelhaft enorm wichtige Buch enthält die 2023 von Benhabib am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen gehaltenen Vorlesungen, in denen die Autorin, ausgehend von Grundgedanken Kants (Stichwort „Weltbürgerrecht“), die Möglichkeiten auslotet, zu völkerrechtlich verbindlichen kosmopolitischen Standards zu gelangen, die nationales oder transnational übergreifendes Recht des Demos nicht negieren, aber dennoch transzendieren. In ihrem „kosmopolitische Interdependenz“ genannten Ansatz geht es um „eine Einbettung der demokratischen Selbstbestimmung in ein neues internationales Recht interdependenter Souveränitäten“ (53; Hervorh. im Orig.). Das sieht sehr nach der Quadratur des Kreises aus; ob dem so ist oder nicht, wird nur die Praxis zeigen können. Kantische Vernunftorientierung und „kommunikative Ethik“ (gemeint ist Habermas) sind die philosophischen Stützen, auf denen Benhabibs Auseinandersetzung sowohl mit Kritikern des „kantianischen Kosmopolitismus“ (wie der Aristotelikerin Martha Nussbaum), mit dem politischen Liberalismus als auch mit postkolonialen Theoretikern und Kritikern des Eurozentrismus und westlichen Imperialismus (Walter Mignolo, E. Tendayi Achiume, Dipesh Chakrabarty u.a.), aber auch mit Hannah Arendts Kant-Lektüre und Denkern wie Bruno Latour, Carl Schmitt oder Hans Kelsen ruht. Ihr theoretischer Horizont ist so weit, wie es dem Thema – und dem Globus – gebührt und angemessen ist.
Das erste Kapitel ist der Verteidigung des „kantianische[n] Kosmopolitismus“ gegen seine Kritiker gewidmet, die argumentieren, „dass das kantianische Vermächtnis rundweg abgelehnt und eine andere philosophische Grundlage geschaffen werden müsse“ (25). Seine Forderung, dass alle Staaten die republikanische Regierungsform haben sollten, habe Kant nicht auf die europäischen Kolonien und abhängige Staaten bezogen. Benhabibs wichtigster Referenztext ist natürlich Kants Zum ewigen Frieden (1795), daneben die Metaphysik der Sitten (1797/98). Sie verweist auf Kants eigene Entwicklung hinsichtlich seines Denkens über „Rassen“ und auf seine (gelegentliche) Kritik am europäischen Imperialismus. Allerdings muss kritisch zurückgefragt werden, wie viel Kants Verständnis des „Weltbürgerrechts“ (im dritten Definitivartikel, wo er nebenbei massiv „das inhospitable Betragen“ europäischer Kolonialmächte gegenüber fremden Völkern kritisiert), das er ausdrücklich „auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt“ wissen will, also auf ein (zeitweiliges) Besuchsrecht, für ein heutiges Kosmopolitismus-Konzept hergibt – auch wenn er auf den gemeinschaftlichen Besitz „der Oberfläche der Erde“ hinweist, auf der ursprünglich „niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat, als der andere“.
Desgleichen ist zu fragen, wie weit die „Prinzipien der kommunikativen Ethik bzw. Diskursethik“ (25) von Habermas im gegebenen internationalen und völkerrechtlichen System ein Weltbürgertum stützen können. Denn Habermas beharrt in seinem Verständnis der deliberativen Demokratie ja darauf, dass diese sich als Ausdruck von Volkssouveränität stets in einem nationalstaatlichen Rahmen (ggf. einem transnationalen wie dem der EU) organisieren müsse, aus dem also immer jemand ausgeschlossen bleibt (z.B. Flüchtlinge, Asylbewerber). Gleichzeitig verlangt die Diskursethik aber, dass „nur die Normen Geltung beanspruchen dürfen, die die Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden (oder finden könnten)“ (Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, 1983, 103). Das würde bedeuten, dass Asylbewerber bei der Asylgesetzgebung des Landes, von dem sie aufgenommen werden wollen, mitsprechen dürfen. Benhabib übersieht, wie Habermas selbst, diese offensichtliche Unmöglichkeit, um nicht zu sagen: Antinomie.
Anders als etwa die von Benhabib als „Globalisten“ bezeichneten Mitglieder der Gruppe Third World Approaches to International Law (TWAIL) oder E. Tendayi Achiume (von 2017 bis 2022 Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für aktuelle Formen des Rassismus) plädiert Benhabib im zweiten Kapitel ausdrücklich nicht „für eine Welt ohne Grenzen“ (47). Während Achiume „das Konzept der ‚exklusiven Souveränität‘ ins Visier [nimmt], die vorherrschende hegemoniale Vorstellung der westlichen und nördlichen liberalen Demokratien, die es ihnen erlaubt, Migranten und Asylsuchende von ihren Gestaden auszuschließen“ (41), behauptet Benhabib: „Demokratien brauchen juristische Grenzen.“ Denn: „Wir müssen wissen, in wessen Namen ein Gesetz erlassen wird, und wir müssen wissen, wie wir von denen, die es erlassen, und von denen, die dagegen verstoßen, Rechenschaft verlangen können. Wir brauchen sowohl nationale als auch transnationale Gerichte, um den Schutz und die Stärkung von Rechten sowie die Bestrafung von Tätern, die sie verletzen, zu gewährleisten. Aber diese Grenzen der Gerichtsbarkeit sind nicht gleichbedeutend mit militärisch bewaffneten und gewaltsam bewachten Grenzregimen“ (47 f.).
Man sieht, wie sehr Benhabib auf das Recht, insbesondere das Völkerrecht, baut. Das ist gewiss gut gemeint, verkennt jedoch, dass erstens das Recht grundsätzlich ein Gewaltverhältnis ist, und dass zweitens die Sanktionsgewalt, die hinter dem Völkerrecht steht, zweifelhaft ist. Ist ein Staat mächtig genug, internationales Recht ohne die Gefahr von Sanktionen zu brechen (etwa weil er im UN-Sicherheitsrat eine Vetostimme hat oder eine Vetomacht ihre schützende Hand über ihn hält), dann tut er es. Die Geschichte kennt genügend Beispiele. Die Ohnmacht des Internationalen Gerichtshofs wurde z.B. 1984 und 1986 von den USA vorgeführt, die das Urteil gegen sie wegen Unterstützung der Contra-Rebellen in Nicaragua und Verminung der nicaraguanischen Häfen schlicht ignorierten. Als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der britischen Regierung die Abschiebung von Asylbewerbern nach Ruanda im Juni 2022 untersagte, erklärte die Regierung, man könne aus dem Europarat und der Europäischen Menschenrechtskonvention ja auch austreten und die Zustimmung zur Genfer Flüchtlingskonvention widerrufen. Das Völkerrecht macht mächtige Regierungen nicht zittern. Die Regierungen in dieser Welt, die nicht jederzeit aus Opportunismus Menschenrechte verletzen, kann man vermutlich an einer Hand abzählen. Sich auf das Recht und Gerichte zu verlassen, ist also nicht unbedingt der erfolgversprechendste Weg zu einer kosmopolitisch gestalteten Welt und für „Projekte der Weltgestaltung und des Welt-Teilens durch gemeinsames Engagement in Praktiken und Institutionen“ (38).
Und warum sollten wir, wie Benhabib behauptet, unbedingt wissen, „in wessen Namen“ ein Gesetz erlassen ist? Die vor Gericht beim Urteilsspruch benutzte Floskel „Im Namen des Volkes“ ist ja nur eine leere und Legitimation bloß erheischende Redeweise. In Deutschland erleben wir gegenwärtig, wie von den „demokratischen Parteien“ das Recht auf Asyl geschleift wird, um rechtspopulistische Ressentiments zu bedienen, und dass auch ein (grundsätzlich auslegungsbedürftiger) Verfassungswortlaut faktisch wenig wert ist. In der von exorbitanter Dummheit zeugenden Interpretation des Bundeskanzlers lautet z.B. das Asylgrundrecht in der Verfassung: „Wir dürfen uns aussuchen, wer zu uns kommen darf und wer nicht.“ (Spiegel 36/2024). Eine deutsche Regierung hält von Projekten „des Welt-Teilens“ so wenig wie jede andere westlich-demokratische Regierung. Benhabib selbst weist darauf hin, dass nach der Entkolonialisierung die wirtschaftlichen Unterschiede fortbestanden und durch „die Funktionsweise der Breton-Woods-Institutionen, die nochmals neuere Techniken zur Aufrechterhaltung von Ungleichheits- und Hierarchieverhältnissen formulierten“ (39), zementiert wurden. Sie schreibt: „Wir müssen fragen: … Wie kann ein interaktiver Universalismus nicht nur im Bereich der Moralphilosophie gedacht werden, sondern ganz konkret als eine Form des Institutionenaufbaus und des Welt-Teilens? Versuche zur Dekolonisierung des Völkerrechts hin zu einem integrativeren Kosmopolitismus können den Weg weisen.“
Gibt man als Realist zu, dass die Mächtigen und Regierenden der Ersten Welt kein Interesse an einer Dekolonisierung des Völkerrechts und an einem Welt-Teilen haben, bleibt die Frage: Wer soll denn das Wir im „Wir müssen fragen …“ sein? Es sind eben nur ein paar Moralphilosophen (in Europa und USA) und mehrere Aktivisten aus der Dritten Welt. Dass die heutige sogenannte „Migrationskrise“ ein Ergebnis des westlichen Imperialismus ist, wird in der Öffentlichkeit der kapitalistischen Industriestaaten ignoriert oder glatt geleugnet. Benhabib plädiert (mit Achiume) dafür, „die Unterscheidung zwischen dem politisch verfolgten Flüchtling und dem Wirtschaftsmigranten“ endlich aufzugeben. „Angesichts der langen Geschichte des europäischen Imperialismus in Afrika, Südamerika und dem Rest der Welt ist diese Unterscheidung zwischen dem unehrenhaften Wirtschaftsmigranten und dem ehrenwerten politischen Flüchtling heuchlerisch und unhaltbar“ (42). Vom deutschen Kanzler jedoch werden die Wirtschaftsmigranten bekanntlich als diejenigen bezeichnet, „die kein Recht haben, hier bei uns zu sein.“ Woran man einmal mehr sieht, dass Recht (das seiner Natur nach sowieso kontingent ist) stets sehr beliebig interpretiert und verwendet werden kann.
Das dritte, mit „Der Globus als Welt, Erde und Planet“ überschriebene Kapitel beleuchtet die durch im Anthropozän erzeugten globalen Problematiken (vor allem die Klimakrise) aus Chakrabartys „planetarischer“ Perspektive, die das Globale „überschreibt“, und mit Bruno Latours Konzept des „Terrestrischen“. Beide streben eine „epochale Neuorientierung im Denken“ (63) an, die Benhabib mit der Kritik an moderner Wissenschaft und Technologie sowie moderner Politik konvergieren sieht, „wie sie von der bekannten Tradition des antimodernen reaktionären Denkens vertreten wird, für das die Philosophen Heidegger und Schmitt stehen.“ (ebd.) Über Hannah Arendt, die bekanntlich einen Weltstaat und ein Weltbürgertum ablehnte, und deren Dialog mit Karl Jaspers (dessen Buch Die Atombombe und die Zukunft des Menschen 1957 erschien) kommt Benhabib, die Gefahr des Atomkriegs und den Klimawandel implizit nebeneinanderstellend, zu Arendts schon 1958 vorgetragener Einsicht und zitiert: „Diese auf Furcht vor globaler Zerstörung gegründete negative Solidarität [Hervorh. B. Sch.] ist begleitet von einer weniger evidenten, aber nicht weniger wirksamen Befürchtung politischer Natur. Positive Solidarität im Politischen kann es nur geben auf Grund gemeinsamer Verantwortlichkeit“ (67).
Wie Arendt folgt auch Benhabib Kants Behauptung in Zum ewigen Frieden, dass ein Weltstaat „ein seelenloser Despotism“ sei, der nicht die „Idee des Völkerrechts“, nämlich „die Absonderung vieler von einander unabhängiger benachbarter Staaten“ ersetzen dürfe – ohne zu fragen, wie plausibel Kants Begründung („Aber die Natur will es anders.“) wirklich ist. Dass Staaten, die ja grundsätzlich um Investitionen, Ressourcen, Arbeitskräfte und Macht konkurrieren, selten zu tragfähigen und nachhaltigen Kooperationen finden und ihrer „gemeinsamen Verantwortlichkeit“ eben nicht nachkommen, was man auch tagtäglich auf den ersten Blick sieht, ignorieren Kant, Arendt und Benhabib gleichermaßen. Mit den Überlegungen von Chakrabarty decke sich, schreibt Benhabib, Arendts (sowie Jaspers‘) Urteil, „ ‚daß das Auftreten der Menschheit als greifbare politische Realität das Ende der in der Achsen-Zeit beginnenden Weltgeschichte kennzeichnet … Was jetzt nach dem Ende der Weltgeschichte beginnt, ist die Geschichte der Menschheit“ (68). Bei dieser Denkfigur der „eigentlichen“ Geschichte der Menschheit „nach“ dem Vorhergegangenen darf man sich an einen ähnlichen Gedanken im Marxismus erinnern. Jedoch genau davon setzt sich Benhabib ab: „Aber diese ‚Menschheit‘, die am Ende jener Epoche der Weltgeschichte auftaucht, ist keine Spezies – kein ‚Gattungswesen‘, wie Feuerbach oder Marx vielleicht gesagt hätten. Die Philosophie der Menschheit darf den Menschen nicht als ein singuläres Subjekt betrachten, das ‚im einsamen Dialog zu sich selbst‘ redet, sondern als ‚die Menschen, die miteinander reden und sich verständigen‘. Die conditio humana ist eine Pluralität, nicht Singularität.“ (68; Zitate aus: Hannah Arendt, Menschen in finsteren Zeiten). Fraglich an dieser Marx-Kritik ist freilich, warum man das Gattungswesen nicht als Pluralität denken können sollte. Der grammatikalische Singular impliziert nicht notwendig eine semantische Singularität.
Offen bleibt also am Ende des Buches, wie die Einbettung demokratischer Selbstbestimmung vieler einzelner Staaten in das neue internationale Recht „interdependenter Souveränitäten“ vor sich gehen und wie diese Interdependenz sich gestalten soll. Die Interdependenz besteht ja bereits, nur ohne jeden positiven Effekt für einen Kosmopolitismus. Ebenso bleibt unklar, wie sich „die Ideale der kommunikativen Ethik mit dem kosmopolitischen Ansatz“ verknüpfen lassen, ohne die sogenannte demokratische Selbstbestimmung (die Volkssouveränität) weitestgehend auszuhebeln. Vor allem vergisst Benhabib (wie schon Kant und Arendt), dass es faktisch keinen „gemeinschaftlichen Besitz der Oberfläche“ der Erde gibt. Die Erdoberfläche (Grund und Boden) ist längst überwiegend das private Eigentum von Konzernen (juristischen Personen) und natürlichen Personen. Und Privateigentum bedeutet immer den willkürlichen Ausschluss anderer Personen vom Gebrauch. Gerade in Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre ist dies die raison d’être des Rechts. Der Kosmopolitismus kann sich mithin bestenfalls auf einen halbierten Kant berufen.
Insgesamt kommt das Buch also nicht über den Appell hinaus, von dem man jedoch nach aller Erfahrung weiß, dass er bei den relevanten Institutionen, Politikern und Wirtschaftsführern auf taube Ohren stoßen wird.