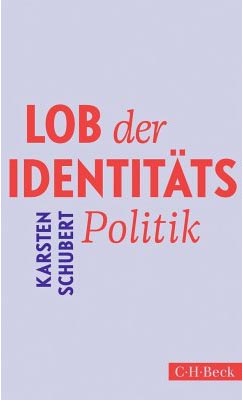Karsten Schubert
Lob der Identitätspolitik
br., 223 Seiten, 20,– €, C. H. Beck Verlag, München 2024
von Paul Stephan
Die Debatte um „Identitätspolitik“ hat derzeit keine so starke Konjunktur wie noch vor einigen Jahren. Die wesentlichen Argumente, so der Eindruck, liegen auf dem Tisch und die gesellschaftliche Debatte widmet sich verstärkt womöglich drängenderen Fragen. Der entscheidende Wendepunkt war wohl die Corona-Krise, gefolgt vom Ukraine-Krieg. Freilich dürfte es sich dabei nur um einen vorübergehenden Waffenstillstand, nicht um ein Ende des Konflikts handeln; denn zu den Themen dieser Debatte wurde mitnichten ein breiter Konsens gefunden – sie werden uns also vermutlich früher oder später erneut einholen.
Insofern kommt Karsten Schuberts Monographie Lob der Identitätspolitik womöglich ein wenig zu spät – vielleicht aber auch zur richtigen Zeit, in der die (relative) Stille zum Anlass genommen werden kann, inne zu halten und zu fragen: Was ist in den letzten Jahren in Sachen „Identitätspolitik“ eigentlich genau passiert? Was hat sie uns gebracht? Sollte sie unverändert fortgesetzt werden – oder lieber nicht?
Der Titel des Buches wie seine Kernthesen haben indes das Potential, sogar Befürworter der „Identitätspolitik“ zu provozieren. Denn oft wird von denen, die als solche von außen bezeichnet werden, geleugnet, dass es „Identitätspolitik“ oder verwandte Phänomene wie political correctness, cancel culture oder wokeness überhaupt gibt. Offene Verteidigungen der Identitätspolitik sind selten. Indem sich Schubert so dezidiert zur Identitätspolitik bekennt, gelingt ihm eine Öffnung der Debatte, die wir dringend benötigen.
Sehr unverstellt gesteht Schubert zudem ein, was von denjenigen, die Identitätspolitik betreiben – wie gesagt: oftmals nicht in der Selbstbeschreibung –, geleugnet oder zumindest relativiert wird: Identitätspolitik ist kein Nullsummenspiel in dem Sinne, dass sie niemandem etwas wegnehmen würde. Sie nimmt vielmehr Menschen, die sich in „privilegierten“ Positionen befinden, etwas weg und verteilt Privilegien um. Der vehemente Widerstand gegen die Identitätspolitik ist aus Schuberts Sicht also keine Überraschung, sondern der erstmal nachvollziehbare Kampf um die Verteidigung bisheriger Privilegien, die man zu Recht als gefährdet ansieht. Auch in dieser Hinsicht ist Schubert seine ehrliche Herangehensweise hoch anzuerkennen, zumal sie seine Argumentation ja nur stärkt.
Das Buch ist zwar als Monographie erschienen, doch eigentlich ist es in weiten Teilen eine Zusammenstellung diverser Fachartikel, die Schubert in den letzten Jahren zu diesem Themenkomplex publiziert hat. Dies merkt man ihm leider beim Lesen an. Nicht nur ist es stellenweise repetitiv, stilistisch bewegt es sich auch sehr in einem akademischen Duktus. Dies bringt natürlich den Vorteil der Versachlichung der oft hitzig geführten Diskussion mit sich, doch abgesehen davon, dass es bisweilen etwas ermüdend ist, Schuberts sehr kleinteiligen Ausführungen zu folgen, könnte man in diesem sehr um Sachlichkeit bemühten Stil auch eine Methode erkennen: Man macht sich unangreifbar dadurch, dass man ein –scheinbar – in sich geschlossenes Gedankensystem konstruiert, in dem jeder mögliche Einwand dem Anspruch nach schon reflektiert und beantwortet wird. Die Zielgruppe des Buches dürfte vor diesem Hintergrund vor allem ein akademisches Publikum sein oder akademisch gebildete Funktionäre von sich für identitätspolitische Themen engagierenden Institutionen, die sich seiner Argumente und Begriffe in der öffentlichen Debatte bedienen können; ein breites Publikum oder gar erklärte Gegner der Identitätspolitik dürfte es jedoch nicht erreichen. Es belehrt eher, als dass es zu überzeugen versucht – und wer möchte schon belehrt werden? Es ist ein Buch für Bürokraten – womit womöglich schon auf ein zentrales Problem der realexistierenden Identitätspolitik verwiesen ist.
Wie möchte Schubert die Identitätspolitik nun angesichts der Tatsache verteidigen, dass sie eben durchaus Freiheitsverluste bedeutet, in manchen Fällen vielleicht sogar für sehr viele Menschen, die große Mehrheit der Bevölkerung? Schuberts entscheidender Zug besteht darin, den Begriff der „Demokratie“ umzudefinieren im Rekurs auf die poststrukturalistische „radikale Demokratietheorie“ – d. h. vor allem auf Foucault und sogar, ausgerechnet, auf Nietzsche. Im Sinne dieses „radikalen“ Begriffs von Demokratie gehe es um eine „Demokratisierung der Demokratie“ (8). Es sei daher zu hinterfragen, wer eigentlich Teil des demokratischen dêmos sei, und wer sich in welcher Position am demokratischen Diskurs beteiligen könne. Eine echte Demokratie sei nur erreicht, wenn letztlich alle Menschen Teil des dêmos sind und gleichberechtigt an diesem Diskurs teilhaben können.
Identitätspolitik definiert Schubert als genau die Bewegung zu einer solchen Demokratisierung. Er unterwirft sie also einem universalistischen Maßstab und versucht dadurch, Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, die ihr Partikularismus vorwerfen. Er unterscheidet allerdings zwischen wirklicher Identitätspolitik, die den Prozess der Demokratisierung auch tatsächlich voranbringt, und bloß partikularer Interessenpolitik, die ihn im Gegenteil blockiert, hemmt oder gar umzukehren versucht. Auch autoritäre und undemokratische Formen der Identitätspolitik kritisiert Schubert vor diesem Hintergrund, auch wenn er diese unterm Strich als „Einzelfälle“ abtut und vor allem immer wieder – und dies ist im Wesentlichen sein „Linksnietzscheanismus“ – betont, dass es bei der Identitätspolitik nun einmal um Macht gehe, und die unterdrückten Minderheiten keine andere Möglichkeit hätten, als die ihnen angetane Gewalt durch eine mitunter gewaltvolle Machtpolitik zu beenden.
Vor diesem Hintergrund beschreibt Schubert Demokratisierung als einen unendlichen Prozess, bei dem es immer wieder darum gehe, dass bisher unterdrückte Minderheiten das ihnen zustehende Maß an Mitsprache erhalten und die Institutionen sich dadurch verändern. Identitätspolitik drohe vor diesem Hintergrund freilich auch – wie Schubert am Beispiel des „transexkludierende(n) radikale(n) Feminismus“ (169) diskutiert – immer wieder in Interessenpolitik umzukippen, wenn sie sich mit einem bestimmten Niveau an Demokratisierung begnügt und nicht die Anliegen immer neuer unterdrückter Gruppen einbezieht.
Dieser Begriff von Identitätspolitik ist nun sehr weit. Schubert begreift sogar den marxistischen Klassenkampf als eine Form derselben (vgl. 25) und wirbt am Ende des Buches für eine identitätspolitische ‚Neuentdeckung‘ des Klassenkampfs: Die Antwort auf die linke Kritik an der Identitätspolitik bestehe also nicht in weniger, sondern in mehr Identitätspolitik (vgl. 183-187).
Diese Bezugnahme auf Marx überzeugt ebenso nur bedingt wie die auf Nietzsche. Was Nietzsche angeht, gesteht er selbst zu, dass es ihm eher um eine lose Anknüpfung aus der Brille der poststrukturalistischen Nietzsche-Interpretation geht (vgl. 69). Was Marx betrifft, liegt der Einwand nahe, ob die Analogisierung ökonomischer und kultureller Unterdrückungsverhältnisse wirklich aufgeht. Marx ging davon aus, dass die ökonomische Unterdrückung des Proletariats die Wurzel aller Unterdrückungsverhältnisse ist und das „Proletariat“ die übergroße Mehrheit der Bevölkerung moderner kapitalistischer Gesellschaften umfasst. Wenn Arbeiter sich um höhere Löhne oder gar um die Aneignung der Produktionsmittel bemühen, scheint das ein völlig anders gearteter Kampf zu sein als derjenige für Gendersprache oder geschlechtsneutrale Toiletten.
Der Haupteinwand gegen Schuberts detailliert ausgearbeitete und an vielen Stellen wirklich erhellende Konstruktionen dürfte jedoch darin liegen, dass sie mitunter wie „bloß theoretische Gedankenblasen“ (167) wirken, die mit der realexistierenden Identitätspolitik und ihren Problemen wenig zu tun haben. Auch wenn Schubert, wie erwähnt, eingesteht, dass es problematische Formen der Identitätspolitik gibt und er dieser keine „carte blanche“ (167) ausstellen möchte, wagt er sich doch selten an die Diskussion konkreter „Einzelfälle“ (166) bzw. fallen seine spärlichen Ausführungen dazu eher apologetisch aus.
So übernimmt er den schon erwähnten Begriff des „transexkludierende(n) radikale(n) Feminismus“, kurz: TERF, der oft jedoch als beleidigend wahrgenommen wird. Immer wieder wird darauf hinwiesen, dass er ähnlich wie ‚turd‘, deutsch: Scheißhaufen, klingt, und er wird im aktivistischen Sprachgebrauch auch immer wieder als Schimpfwort verwendet. Schubert tut so, als handele es sich um einen völlig neutralen wissenschaftlichen Begriff und spricht zwar von einer „regelrecht hasserfüllt[en]“ (170) Debatte, doch meint er damit ausschließlich die feministische Kritik am queeren Feminismus, nicht aber die zahlreichen Fälle von Beschimpfungen, Mobbing bis hin zu physischer Gewalt, die sich mitunter seitens „Trans-Aktivist*innen“ gegen ihre Kritiker richtet.11
Ein wenig komisch ist es auch, wenn Schubert dann die Diskriminierung von Radfahrern gegenüber Autofahrern als Beispiel für den identitätspolitischen Kampf zwischen Privilegierten und Unterdrückten anführt (vgl. 55). Zwar mag es sein, dass Autofahrer aus physischen Gründen im Straßenverkehr strukturell privilegiert sind; doch die Mehrzahl der Autofahrer dürften unterprivilegierte Lohnarbeiter mit Familie sein, die auf ihr Auto angewiesen sind – von Krankenwägen, Polizeiautos, Lieferfahrzeugen etc. abgesehen –; Radfahrer hingegen sind vielfach Studierende oder Angestellte, die das Privileg haben, nah an ihrem Arbeitsort zu wohnen und sich in ihrer Arbeit körperlich nicht allzu sehr verausgaben zu müssen.
Diese Beispiele zeigen, dass es kompliziert wird, wenn es um Identitätspolitik in ihrer empirischen Konkretion geht. Insbesondere ist oft nicht klar, wer denn nun eigentlich privilegiert ist und wer nicht, und wie sich das überhaupt klar bemessen lässt bzw. wer berufen ist, diese Bemessung vorzunehmen. Es ist dies eine Sache spezifischer Konstellationen und Situationen. Schubert wirft dieses Problem an mehreren Stellen seines Buches selbst auf, doch scheint er dessen Tragweite deutlich zu unterschätzen. Denn in Wahrheit gibt es ‚die Privilegierten‘ nicht, gegen die das identitätspolitische Anliegen von der ‚Bremse‘ woker Aktivisten angetrieben werden müsse, die ‚die Unterdrückten‘ repräsentieren, sondern es gibt eine Vielzahl in unterschiedliche Machtgefüge eingebundener Individuen.
In dieser Vielfalt schafft Identitätspolitik künstliche Teilungen, die oftmals zu der grotesken Situation führen, dass (relativ) privilegierte Akademiker mit gut bezahlten Jobs, die sie in vielen Fällen genau ihrem Aktivismus verdanken, Arbeiter und Arbeitslose mit erhobenem Zeigefinger darüber belehren, wie privilegiert und wohlbetucht sie in Wahrheit doch seien, und dass sie unbedingt diesen oder jenen Verzicht leisten sollten. Dass dies bei den Adressaten nicht gut ankommt, ist sonnenklar.
Das Kernproblem des Buches aber ist das Demokratieverständnis Schuberts, auf dem seine gesamte Argumentation fußt. Das wird deutlich, wenn er darüber spricht, wie er sich die Demokratisierung von kulturellen Institutionen wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk konkret vorstellt. In diesen soll es nicht darum gehen, die Mehrheit der Bevölkerung zu repräsentieren – was unter Umständen das Gegenteil dessen bewirken würde, was Schubert sich wünscht –, sondern den Anliegen diverser Minderheiten ein größeres Gehör zu verschaffen: „marginalisierte Gruppen [sollen] eine Stimme bei Mittelallokation und Programmgestaltungen haben und besser in Rundfunkräten repräsentiert“ (89) werden. Dass derartige Maßnahmen von denen, die diese Institutionen durch Gebühren, Steuern oder Eintrittsgelder finanzieren, als autoritär wahrgenommen werden und zu einer noch größeren Entfremdung von ihnen führen dürfte – bis hin zur Option für offen rechtsradikale Parteien –, wird von Schubert in Kauf genommen.
Dass sie also – vor dem Hintergrund des gewöhnlichen Demokratiebegriffs – notwendig als undemokratisch und autoritär erscheint, ist das eigentliche Problem nicht nur der von Schubert konzipierten Identitätspolitik, sondern auch das einer Demokratie, die nicht in der Repräsentation und Teilhabe der Mehrheit der Bevölkerung an den sie betreffenden politischen Entscheidungen besteht, sondern als eine Art Diktatur ‚diverser‘ Minderheiten über die Bevölkerungsmehrheit. Auch Marx und Engels sprachen bekanntlich von der „Diktatur des Proletariats“; doch dieses Problem stellte sich ihnen, jedenfalls in der Theorie, nicht, da das zu befreiende Proletariat ja per definitionem die übergroße Bevölkerungsmehrheit war.
Es ist nicht so, dass Schubert nicht einen tatsächlich blinden Fleck im gewöhnlichen Demokratiebegriff aufzeigen würde, der ja stets die Gefahr einer ‚Diktatur der Mehrheit‘ impliziert. Der liberale Kompromissvorschlag bestand daher darin, diese Diktatur durch die Gewährung verfassungsmäßig garantierter und durch Mehrheitsbeschlüsse kaum zu ändernder individueller Freiheitsrechte zu verhindern. Es wurden so, zumindest im Privaten, Schutzräume für die Minderheiten möglich. Doch dieser Kompromiss ist in der Tat faul; denn er gerät regelmäßig ins Wanken, wenn Entscheidungen zu fällen sind, die alle betreffen und daher als gemeinsame gefällt werden müssen: So etwa die Fragen, welche Art von Grammatik in den Schulen gelehrt oder wie das Programm des öffentlichen Rundfunks gestaltet werden soll.
Hierin scheint mir das eigentliche Problem zu liegen. So dürften nur wenige ein Problem damit haben, wenn schwule oder queere Menschen ihren Lebensstil im Privaten pflegen oder Feministinnen unter sich ‚gendern‘. Die Streitfragen tauchen auf, wenn es um Entscheidungen geht, die ihrer Natur nach nicht durch liberale Kompromisse zu schlichten sind, sondern bei denen entweder die ‚privilegierte‘ Mehrheit oder die ‚unterdrückten‘ Minderheiten entscheiden müssen (die freilich auch kein geschlossenes Kollektiv bilden und sich oftmals untereinander widersprechen).
Um zu vermeiden, dass Gesellschaften – und nicht zuletzt die emanzipatorischen Bewegungen – sich angesichts solcher Fragen spalten, führt wohl kein Weg daran vorbei, die Demokratie ‚konventioneller‘ zu denken, als Schubert es vorschlägt: Es müssen Kompromisse gefunden werden, mit denen möglichst viele Menschen leben können. Dabei muss es zugleich darum gehen, diejenigen Fragen nicht aus den Augen zu verlieren, bei denen man sich einig ist und die tatsächlich in der Lage sind, große gruppenübergreifende Allianzen zu schmieden. Dies aber sind die ökonomischen und ökologischen Fragen, nicht die kulturellen. Dann aber würde gälten, die Identitätspolitik, die sich primär auf kulturelle Fragen bezieht, hinter sich zu lassen und den Kampf um ökonomische und ökologische Anliegen nicht durch die Fokussierung auf solch potentiell spalterische Fragen zu demontieren. Dies aber ist nicht nur eine Frage der politischen Theorie, sondern vor allem der Machtpolitik, von der auch Schubert wiederholt spricht.
Umgekehrt kann eine Identitätspolitik, die sich gegenwärtig überwiegend als autoritäre Minderheitspolitik darstellt, auf lange Sicht nur scheitern und, wie Schubert auch anerkennt, nicht weniger autoritäre Gegenreaktionen provozieren. Die Kernfrage einer identitätspolitischen Strategie müsste folglich sein, wie genau man identitätspolitische Forderungen der ‚privilegierten Mehrheit‘ schmackhaft machen kann. Auch wenn Schubert einfordert, dass die Mehrheit doch in das Lob der Identitätspolitik einstimmen müsse, bleibt es bei ihm letztlich doch beim moralischen Appell, der dann zur Not eben auch mit machtpolitischen Mitteln durchgesetzt werden muss. Die Alternative zur aktuellen Identitätspolitik wäre auch hier, sich auf die Forderungen zu konzentrieren, die den ‚Privilegierten‘ wie den ‚Minderheiten‘ gleichermaßen zu Gute kommen: bessere Arbeitsbedingungen, bessere Wohnsituationen, Kampf gegen Naturzerstörung …
Eine andere Weise könnte in der ‚Demoralisierung‘ des identitätspolitischen Kampfes und der Erfindung einer Emotionalisierung bestehen, die in der Lage ist, auch Mitglieder der ‚Privilegierten‘ mitzureißen, sie von identitätspolitischen Forderungen nicht nur abstrakt zu überzeugen, sondern zu begeistern. Hier sind Kunst und eine gekonnte identitätspolitische Essayistik gefragt. In dieser Hinsicht enttäuscht Schuberts Buch leider – es thematisiert diesen Aspekt nicht nur am Rande, ihm gelingt es auch nicht, dafür eine entsprechende Form zu finden. Sein „Lob“ der Identitätspolitik fällt für eine Laudatio sehr nüchtern aus. Es müsste mehr als ein anerkennendes Schulterklopfen sein, sondern eine stürmische Umarmung, die einer vertieften Demokratisierung, wie sie Schubert zu Recht fordert, vorarbeitet. Vielleicht könnte hierbei Nietzsche helfen – nicht als kühler Analytiker der Macht, sondern als Visionär des „Übermenschen“. Identitätspolitik vermag die Massen nur zu ergreifen, wenn sie sich nicht kalt als bürokratisch-autoritäre Umverteilung präsentiert, sondern als ästhetisch-kreative Erfindung einer neuen Gesellschaft.
Diese Gedanken sind freilich nicht neu. Vielmehr müsste Identitätspolitik sich einfach nur auf historische Erfolge rückbesinnen. Wohl kaum eine Rede hat für die Emanzipation der schwarzen Bevölkerung der USA mehr bewirkt als Martin Luther Kings Ansprache I have a dream, in der King in einer mitreißenden religiösen Sprache eine unzweideutig universalistische Vision einer Gesellschaft ohne Rassismus artikulierte. Sein Aktivismus bezog sich stets jedoch nicht nur auf Forderungen des Bürgerrechts, sondern auch auf soziale Rechte. Zudem haben Musik, Literatur, Filme etc. zum Erfolg der antirassistischen Bewegung beigetragen.
In diesem Sinne ginge es also um eine vom Ressentiment befreite Emotionalisierung des Kampfs für identitätspolitische Forderungen, die den „Hass“, mit dem Identitätspolitik oft vorgetragen wird und den sie umgekehrt provoziert, überwindet, um wieder zu einem gemeinsamen linken Projekt zurückzufinden, das nicht als eine autoritäre, phantasielose, hasserfüllte und kleinkarierte Nischenpolitik, sondern als „selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl“ wahrgenommen wird. Einem solchen Lob der Identitätspolitik kann ich mich gern anschließen.
Man denke an Jan Böhmermanns Sendung vom 2.12.22, in der er „TERFs“ nicht nur als „Scheißhaufen“, sondern auch „Nazis“, „dumme Wichser“ und vieles Weitere bezeichnete, und er dafür sogar noch von der Familienministerin Lisa Paus und ihrem Staatssekretär öffentlich gelobt wurde. – Schubert verteidigt seinen Gebrauch des Begriffs „TERF“ auf 221 (Fn. 3). Dass etwa in der Auseinandersetzung mit der britischen Kritikerin des queeren Feminismus, Kathleen Stock, mitunter Grenzen der legitimen Auseinandersetzung überschritten wurden, gesteht er immerhin zu (223; Fn. 8).
Man denke an Jan Böhmermanns Sendung vom 2.12.22, in der er „TERFs“ nicht nur als „Scheißhaufen“, sondern auch „Nazis“, „dumme Wichser“ und vieles Weitere bezeichnete, und er dafür sogar noch von der Familienministerin Lisa Paus und ihrem Staatssekretär öffentlich gelobt wurde. – Schubert verteidigt seinen Gebrauch des Begriffs „TERF“ auf 221 (Fn. 3). Dass etwa in der Auseinandersetzung mit der britischen Kritikerin des queeren Feminismus, Kathleen Stock, mitunter Grenzen der legitimen Auseinandersetzung überschritten wurden, gesteht er immerhin zu (223; Fn. 8). ↩︎