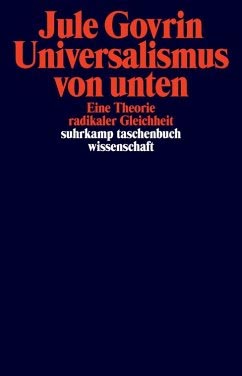Jule Govrin
Universalismus von unten. Eine Theorie radikaler Gleichheit
br., 498 Seiten, 28,- €, Berlin 2025 (Suhrkamp-Verlag)
von Fritz Reheis
Der Begriff „Gleichheit“ wird üblicherweise entweder mehr „formal“ oder mehr „material“ verstanden. Formal verweist dabei auf den Bezug zu einer formalen Ordnung wie etwa einem System von Verträgen, einem formal gedachten Markt oder Staat. Material hingegen bezieht sich auf Substanzielles, also faktische Eigenheiten von Objekten oder Subjekten, wobei in der Kritischen Theorie in aller Regel soziale Aspekte wie die Verfügung über Ressourcen, vor allem Eigentum und Macht, im Zentrum stehen.
In „Universalismus von unten“ wird materiale Gleichheit nun auf eine andere Weise konkretisiert: Sie wird auf den menschlichen Körper bezogen, also gewissermaßen eine Stufe tiefer als in den üblichen Diskussionen zur materialen Gleichheit. Am Körper ist es seine Verwundbarkeit, aus der heraus Jule Govrin ihre Überlegungen zu Gleichheit und Ungleichheit entwickelt. Govrin ist Philosophin, hat derzeit eine Gastprofessur an der Universität Hildesheim und bekennt sich zu einem feministischen Ansatz in Philosophie und politischer Theorie. In „Universalismus von unten“ will sie hauptsächlich an Judith Butlers Körper-, Rancières Ungleichheits- und Bourdieus Habitusbegriff anknüpfen, um durch ein „lose verflochtenes Gewebe der Denkstränge“ zu einer „Theorie radikalrelationaler Gleichheit“ zu gelangen (378). Präsentiert wird allerdings streckenweise ein fast unübersehbares Geflecht, aus dem heraus Govrin immer wieder eigene theoretische Gedanken und empirische Belege aufblitzen lässt.
Die These des Buches lautet: Körper sind dadurch definiert, dass sie von Anfang an existenziell wechselseitig voneinander abhängig und insofern verwundbar sind. Ausgehend von Körpern muss Ungleichheit deshalb als ungleiche Verwundbarkeit verstanden werden, und zwar als eine Verwundbarkeit, die sozial gezielt hergestellt wird. Zum Beispiel sind es Schulden- und Austeritätspolitiken, die als Formen differentieller Ausbeutung begriffen werden müssen und Menschen ungleich machen. Auf der Suche nach einem Weg zur Gleichheit setzt Govrin nicht auf den Staat, klammert ihn aber auch nicht aus. Sie plädiert für körperliche Gleichheitspraktiken, die sie in Formen gelebter Sorgearbeit und gelebter Solidarität findet. Die „Herausforderung für solidarische Praktiken“ liege darin, „Bewusstsein über asymmetrische Beziehungen zu schaffen und den Blick für Ungleichheit zu schärfen“ (388). Gelebte Sorge und Solidarität, traditionellerweise Grundanliegen der christlichen und kommunistischen Moral, finde sich heute etwa in Streik-, Schuldnerbewegungen, in Initiativen gegen Zwangsräumungen oder für eine „Sorgende Stadt“ – die alle ganz wesentlich von Frauen getragen würden. Dort werde körperlich erfahren, wie es sich anfühlt, aufeinander zu achten, die unterschiedlichen individuellen Lebenssituationen zu berücksichtigen und sich dennoch die gleiche soziale Betroffenheit bewusst zu machen, für deren Überwindung man sich zusammengefunden hat. Versammlungen seien die konkreten Orte, „wo Worte nicht vom Körper getrennt werden können“, „wo die eigene Stimme zu erheben bedeutet, zu gestikulieren, zu atmen, zu schwitzen und zu spüren, dass die Worte gleiten und in den Körpern anderer aufgefangen werden“ (Verónica Gago; 400). Körperlich gelebte Gleichheit ermögliche die „Gegendressur“ (Bourdieu), aus der heraus ein „Universalismus von unten“ begründet werden könne.
Das Buch fasziniert durch seinen Ansatz beim Körper und seiner Verwundbarkeit. Es ist klar gegliedert in I. Körper, II. Ökonomie und III. Gleichheit. Aber die Lektüre der nahezu 500 Seiten lässt den Rezensenten angesichts der Quantität der Anknüpfungspunkte an andere Autoren bisweilen nicht nur den Überblick verlieren. Nicht immer wird klar, was nun eigentlich von der Autorin selbst stammt, und was in diesem Buch nur neu kombiniert wird. Eine etwas systematischere Herangehensweise, etwa an der Unterscheidung zwischen deskriptiven, analytischen und präskriptiven Aussagen zu Gleichheit/Ungleichheit orientiert, hätte die Überzeugungskraft der sozialphilosophischen Argumentation erhöht. Dennoch ist das Buch, wie in der „Süddeutschen Zeitung“ treffend formuliert, ein wirksames „Gegengift“ zum „libertären Autoritarismus“, der derzeit weltweit Konjunktur hat und mit dem Bild der „Kettensäge“ den Bezug zur körperlichen Dimension von Ausbeutung bestens veranschaulicht.