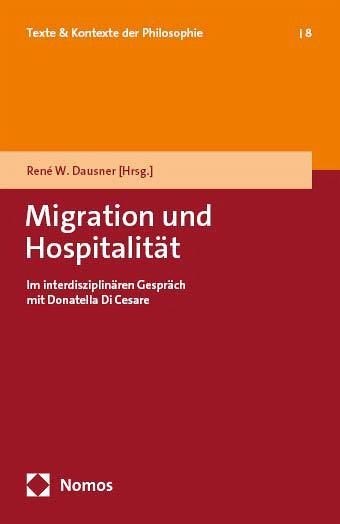René W. Dausner (Hg)
Migration und Hospitalität. Im interdisziplinären Gespräch mit Donatella Di Cesare
br., 224 Seiten, 29,00 Euro
Baden-Baden 2025 (Nomos-Verlag)
von Bernhard Schindlbeck
Es geht hier um ein eminent wichtiges und interessantes Buch, das den Leser, der sich ernsthaft darauf einlässt, wirklich ins Nachdenken bringt. Wichtig ist es schon deshalb, weil es dankenswerterweise deutlich macht, inwiefern seit 2015 die politische, aber auch die akademische Diskussion über Migration von einem extrem verengten und bornierten Standpunkt aus, vorwiegend dem einer allfällig behaupteten „territorialen Souveränität“ einer vermeintlich „autochthonen Bevölkerung“ geführt wird. Ziel des Buches ist, wie Herausgeber René Dausner schreibt, den „innovativen Ansatz der italienischen Philosophin Donatella Di Cesare aufzugreifen und in einem ausführlicheren Kontext zur Geltung zu bringen“ (9). Die Beiträge beziehen sich in unterschiedlicher – zustimmender, kritischer, ergänzender und weiterführender – Weise auf Donatella Di Cesares Buch Philosophie der Migration (deutsch 2024), dessen aussagekräftiger Originaltitel Stranieri residenti. Una filosofia della migrazioni im Deutschen nicht hinreichend zur Geltung kommt; denn, so Dausner, die „zentrale Figur des Buches ist der ansässige Fremde“ (10). Es geht also um den Umgang mit Fremden, Fremdheit und Alterität, um Grenzen bzw. Ausgrenzung, Territorien, Wanderung, Gastfreundschaft, gemeinsames Wohnen, Recht und Rechtlosigkeit.
Nach der Einleitung des Herausgebers folgt zunächst Di Cesares eigener Beitrag Wer sind die Migranten? Versuch einer Phänomenologie, bevor in zehn Aufsätzen aus mehreren Perspektiven verschiedene Interpretationen, Einwände, Bezüge zu anderen philosophischen Ansätzen (vor allem zu Derrida und Levinas) und zu historischen Vorgängen und Entwicklungen entfaltet und diskutiert werden. Den Schluss bildet eine Replik Di Cesares auf die kritischen Anmerkungen und auf Darstellungen, in denen sie sich nicht richtig verstanden sieht.
Johann Szews (Magdeburg) nimmt im Ausgang von Carl Schmitts Demokratie-Verständnis („Zur Demokratie gehört also erstens Homogenität und zweitens – nötigenfalls – die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen“) das in den meisten politischen Migrationskonzepten heute vorherrschende Phantasma der Homogenität der in den staatlichen Grenzen lebenden Bevölkerung in den Blick und zeigt, inwiefern die Vorstellung der Homogenität der Bevölkerung eine von (nicht nur rechtsextremen) Politikern gern und gezielt bediente Vorstellung ist, um die „Identität eines Volkes“ zu konstruieren, „bevor soziale Unterschiede ins Spiel kommen können“ (93). Die behauptete Homogenität einer angeblichen autochthonen Bevölkerung hat selbstredend einen ideologisch-integrierenden Zweck, der zu der Exklusionsdynamik führt, die gegenwärtig zu beobachten ist. „Weil die Volksgemeinschaft auf Bestätigung gegenüber der Realität angewiesen ist, sich immer wieder neu gegen die letztendliche Unbestimmtheit der Grenzen des Volkes bestimmen muss, werden ständig ‚Gemeinschaftsfremde‘ markiert und ausgegrenzt“ (94). Dagegen formuliert Di Cesare „eine migrationsphilosophische Intervention, die jedem Phantasma der Homogenität widerspricht und stattdessen die Position irreduzibler Heterogenität und Fremdheit einnimmt. Es geht ihr um eine Umkehrung der Perspektive: Die Philosophie sollte aus der Perspektive der Migrant:innen denken, und nicht den Blick der Volksgemeinschaft oder der staatlichen Souveränität übernehmen“ (98 f.).
Eine wichtige Klarheit schaffen Andreas Hetzel und Amanda Malerba (Hildesheim) mit der Feststellung: „Di Cesare sucht nicht [wie so viele andere Publikationen, kann man als Leser gedanklich ergänzen], einfach nach Antworten auf das vermeintliche ‚Problem‘ der Migration oder auf eine vermeintliche ‚Migrationskrise‘. Dieser Begriff, der seit 2015 auch in der akademischen Philosophie verwendet wird, zeichnet die Sesshaftigkeit und das Privileg, über ein Territorium als exklusiven Besitz zu verfügen, von vornherein als Normalform aus. Dafür steht exemplarisch die von der GAP (Gesellschaft für analytische Philosophie) im Jahr 2015 ohne jede Ironie ausgeschriebene Preisfrage ‚Welche und wieviele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen?‘ In dieser Frage manifestiert sich ein im Sinne Michel Foucaults ‚gouvernementales‘ oder im Sinne Jacques Rancières ‚polizeiliches‘ Verständnis des Philosophierens als Instanz einer sozialtechnischen Problemlösung bzw. einer Abarbeitung von Kollateralschäden des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses“ (48). In ihrem Beitrag Migration und Kohabitation referieren sie (ausführlicher als einige andere Autoren) Di Cesares Vergleich des Umgangs und Zusammenwohnens mit den Fremden in den antiken Städten Athen, Rom und Jerusalem. Athen war die „erdverbundene“ souveränistische Stadt der Autochthonie, die anderen die Zugehörigkeit strikt verweigerte, während Rom mit seiner Expansionspolitik und dem „Versuch, die Eroberten an das Imperium zu binden“ (52), in seinem offeneren Konzept die Bürgerschaft „ausschließlich juristisch“ definierte und von Geburt, Herkunft und Wohnort löste. Schon Aeneas war ja ein Flüchtling. „Das biblische Jerusalem“ jedoch, „das uns aus der Tora und dem Talmud bekannt ist, erlaubt uns aus Di Cesares Sicht, die Dichotomie von Staatsbürgern und Fremden vollends zu dekonstruieren. Diese Dekonstruktion wird möglich, weil sich Fremdsein und Wohnen in der ‚hebräischen Landschaft‘ nicht trennen lassen. Jerusalem ist vor allem die Stadt des [hebr.] ger, des ansässigen Fremden: Alle, die ‚hier‘ sind, sind ‚nicht von hier‘, so dass die Rede von Fremden ihren Sinn verliert.“ Die Fremdheit bilde damit, wird Di Cesare zitiert, „den Grund und das Fundament von Gemeinschaft“ (53).
Judith Kohlenberger (Wien) fragt ganz direkt: Wem gehört das Land?, um das „Spannungsverhältnis zwischen Universalität und Souveränismus“, in dem der „ansässige Fremde“ sich befindet, auszuloten. „Der universelle Anspruch von Menschenrechten stand von Beginn an den speziellen Rechten, die der Staatsbürgerin zuteilwerden, diametral gegenüber“ (153). Sie verweist auch auf das von Chantal Mouffe konstatierte „demokratische Paradox“, dass die von den politischen Prozessen Ausgeschlossenen als ansässige Fremde dennoch den von den Eingeschlossenen gemachten Gesetzen (z.B. als Steuerzahler) unterworfen sind, ohne auf diese Einfluss nehmen zu können. „Ja mehr noch, sie sehen sich dem rechtlichen Zirkelschluss gegenüber, dass das Volk bestimmt, wer auch perspektivisch zum Volk gehören darf, und zu welchen Bedingungen“ (152). Eine unfreiwillige Bestätigung für diesen territorialen Souveränismus und die Sesshaftigkeit als „Privileg, über ein Territorium als exklusiven Besitz zu verfügen“ (Hetzel/Malerba, 48), liefert etwa Julian Nida-Rümelins Buch Über Grenzen denken. Eine Ethik der Migration (2017), in dem der Autor genau jenen national-territorialen Besitz-Souveränismus vertritt, gegen den Di Cesare sich wendet. Die „Legitimation von Grenzen“ begründet Nida-Rümelin mit der Analogie der eigenen Wohnung, die für alle Fremden, die nicht in der Wohnung leben, eine „legitime Grenze“ darstelle, denn: „Ich kontrolliere als Wohnungseigentümer oder Mieter den Zutritt zu dieser Wohnung und mein Status als Eigentümer oder Mieter gibt mir individuelle Rechte, darunter das Recht, den Zutritt oder den Aufenthalt zu verweigern, auch im Falle, dass die [fremde] Person gute Gründe hat, sich den Zutritt oder den Aufenthalt zu wünschen“. Nida-Rümelin entgeht hier völlig, dass er juridisch vom schon gesetzten Recht aus und völlig zirkulär argumentiert: Ich habe das Recht, weil ich das Recht habe. Der Fremde hat nur einen „Wunsch“, aber eben kein Recht. Nida-Rümelin dehnt ganz einfach die politische Ideologie des Besitzindividualismus auf einen vermeintlichen nationalstaatlichen „Besitz“ aus, um die inhumane Politik der Zurückweisung von Schutzsuchenden zu rechtfertigen. Mit Ethik hat das zwar nichts zu tun, aber genau so funktionieren die propagandistisch-ideologischen Mechanismen des gegenwärtigen Migrationsdiskurses, der dann die Floskel von der „illegalen Migration“ erfolgreich verbreitet.
Das in Di Cesares Phänomenologie so wichtige „Zusammenwohnen“, das Margit Eckolt (Osnabrück) ins Zentrum ihres Beitrags stellt, würden Nida-Rümelin und die politische Kaste, die er so gerne berät, gar nicht verstehen. „Gerade den Fremden – und hier knüpft Di Cesare an Emmanuel Levinas und Jacques Derrida an – kommt im Blick auf die Frage nach dem Wohnen besondere Bedeutung zu“ (165). Denn der Fremde „erschüttert“ das Wohnen, er „entäußert und entwurzelt“, er „entkoppelt“ von Eigentum, Zugehörigkeit und vom Haben, „und steht für eine Gestalt von Existenz, die mit einem ‚transitorischen Aufenthalt‘ verbunden ist, und so wird diese Gestalt zur ontologischen Grundfigur einer Philosophie der Migration“ (165). Zustimmend zu einem ius migrandi als Menschenrecht zitiert Eckholt ausführlich: „Der Horizont einer Gemeinschaft, der sich von der Nation, der Geburt und der Abstammung losgesagt hat und sich der im Namen des Blutes begangenen Verbrechen sowie der im Namen des Bodens geführten Kriege erinnert, die sich des Exils bewusst ist, die offen ist für Gastfreundlichkeit, die sich in die Lage versetzt, politischen Formen stattzugebnen, in denen das Immune dem Kommunen und Gemeinsamen den Vortritt lässt“ (163). Ekholt betont Di Cesares Anliegen, „die Gastfreundschaft auf [der] Ebene des Rechts zu verankern, und zwar nicht nur wie bei Immanuel Kant als ein ‚Besuchsrecht‘, sondern als ein ‚Wohnrecht‘“ (167).
Annabel Herzog (Jerusalem) kontrastiert Di Cesares Ansatz mit der von dem jüdischen Talmudisten und Religionsphilosophen Daniel Boyarin vorgeschlagenen „No-State Solution“ für Palästina; er hält als orthodoxer Jude die Diaspora für die eigentliche (oder soll man sagen „richtige“) Heimat der Juden, die somit keinen Staat im traditionellen Sinn brauchen. „Für Boyarin hat das Judentum nichts mit der Staatsbürgerschaft zu tun, und daher kann ein Jude Bürger eines jeden Landes sein. Gleichzeitig kann ein Jude nur im Talmud (einer Synekdoche für die jüdische Kultur) national zu Hause sein, der als ‚reisende Heimat‘ dient“ (81). Kritisch vermerkt Herzog die „Tatsache, dass weder Di Cesare noch Boyarin in ihren Büchern politische Leitlinien anbieten“ und „keine konkreten politischen Pläne oder Institutionen vorschlagen“ (85). Denn „das grundlegende Problem der staatszentrierten Souveränität“ und der „Starrheit der Grenzen“ bleibe ungelöst (87). Zur „Sicherung des Wohlergehens der Migrant:innen“ seien Strukturen erforderlich. Wie kann, fragt sie, „unterdrückten Menschen geholfen werden, wenn es keine Strukturen zur Bekämpfung von Herrschaft und Unterdrückung gibt? Zweifellos erhalten die Unterdrückten der Welt derzeit keine angemessene Hilfe, aber würden sie ohne demokratische Souveränität überhaupt Hilfe erhalten?“ (ebd.)
Jürgen Manemann (Hannover) rückt den ethischen Anarchismus Di Cesares in den Vordergrund. Seiner Feststellung: „Migrant:innen besitzen ein Wissen davon, dass die Ordnungen des Zusammenlebens in gewisser Weise einen künstlichen Charakter haben, mithin auch ganz anders aussehen könnten“ (62), liegt eine bedeutende (wenn auch weitgehend ignorierte) politische Einsicht hinsichtlich der Kontingenz des jeweils Bestehenden zugrunde. Di Cesares ethischer Anarchismus beinhaltet mit seinem „Potenzial von produktiven Destabilisierungen“ in seiner Konsequenz, „auch Praktiken einer ‚anarchischen Revolte‘ aufzuspüren, durch die die staatszentrierte Ordnung auf Neues hin aufgebrochen wird“ (65). Als Fazit mündet dieser Beitrag in einer Aufgabe für die Philosophie: „Di Cesare gelingt es, die Notwendigkeit eines ethischen Anarchismus dadurch auszuweisen, dass sie sich den einhegenden Mechanismen exophober Solutionismen entzieht und so das Potenzial von Philosophie als Problemlösungsverweigerungspraxis freilegt. Ein solcher Anti-Solitionismus, der gegen eine Nekropolitik in Stellung gebracht wird, dispensiert die Philosophie allerdings nicht davon, Menschen zu helfen, eine Haltung auszubilden, die eine Praxis lebbar macht, die dem Anspruch eines ethischen Anarchismus entspringt – eine Leerstelle in der ‚Philosophie der Migration‘. Eine Philosophie der Migration hätte deshalb die Aufgabe, auch die lebenspraktische Dimension von Philosophie herauszuarbeiten, um Menschen darin zu empowern, Fähigkeiten zu erwerben, um sich aktiv in das Zusammenleben einzubringen“ (65).
Eine interessante und wohl die radikalste Kritik an die Di Cesare trägt Carsten Lotz (Mannheim) bei. Unter dem Titel Die gescheiterte Migration nimmt er einen Satz aus Di Cesares Nachwort zur deutschen Ausgabe zu seinem Ausgangpunkt: „Als letzte Version des zeitgenössischen Elends, die sogar über die wirtschaftliche Erniedrigung hinausgeht, stellt der Migrant in seiner unrechtmäßigen Nacktheit das Gespenst des Gastes dar, den seiner Sakralität und seines epischen Anderswo entkleideten Fremden.“ In fünf kurzen Abschnitten unterzieht er die Begriffe „Letzte Version des zeitgenössischen Elendes“, „Unrechtmäßige Nacktheit“, „Das Gespenst des Gastes“, „Sakralität und episches Anderswo“ und „Der entkleidete Fremde“ einer so radikalen wie minutiösen Kritik, um zu zeigen, inwiefern Di Cesare „die Begrifflichkeiten einer Philosophie der Sesshaftigkeit und der Identität“ letztlich doch nicht los wird (103). „Ein ius migrandi,“ so Lotz, „kann es nicht als solches geben, weil sich ein Recht auf ein Mitglied einer Gesellschaft bezieht und der Migrant an der Grenze jener Gesellschaft steht“ (108). Er beharrt also darauf, dass die von Kant im „Dritten Definitivartikel zum ewigen Frieden“ formulierte Hospitalität „kein Recht sui generis“ sei, nur ein Besuchsrecht und kein Bleiberecht. „Der Gast kann auch wieder weggeschickt werden, denn das Recht der Hospitalität ist beides: ein Recht des Gastes und ein Recht des Wirtes, eine Pflicht des Gastes und eine Pflicht des Wirtes“ (109). Auch die allgemeine Hospitalität brauche „einen Gastgeber, der sich in seiner Verantwortung für den Gast als solcher erweist. Wenn wir alle nur noch migrieren, gibt es weder Gäste noch Gastgeber. Wenn es nur noch andere gibt und keine Hierarchie mehr, gibt es keine Gerechtigkeit mehr“ (114). Di Cesares „radikaler Pluralismus“ lasse „das Fremde nicht mehr erkennbar werden“ (ebd.). Er fragt, ob aus dem von ihr propagierten ius migrandi nicht „ein ius considendi“ werde, ein „Recht, sich niederzulassen, ein Recht zu siedeln, wie es von den Philosophen der Kolonialzeit auch geprägt wurde“ (111). Zweifelhaft an dieser Kritik ist, weshalb Hierarchie eine Bedingung für Gerechtigkeit sein sollte; ebenso die gedankliche Verbindung von Migration und Besiedlung, wie man sie aus dem Kolonialismus kennt, die durch die assoziativen Vorstellungen von Siedeln, Niederlassung und Landnahme zustande kommt. Genau gegen diese falsche Gleichsetzung von Migranten und Siedlern erhebt Di Cesare in ihrer Replik am Ende des Buches Einspruch, denn die Gleichsetzung fällt zurück in die falsche dichotomische Fixierung auf die Autochthonen und die Fremden.
In seinem Beitrag Ende oder Endlichkeit der Gastfreundschaft kritisiert Stefan Gaßmann (Münster) Di Cesares Lévinas-Interpretation, in der er den „Vorwurf an Lévinas“ entdeckt, „dass dessen Denken dazu führe, Gastfreundschaft als ‚außerpolitische, ethische Instanz‘ zu verstehen“. In einer subjektphilosophischen Wendung denke Lévinas (laut Di Cesare) lediglich die ‚Geste des Empfangs‘, ohne aber eine ‚Philosophie der Aufnahme‘ zu entwickeln, die „der konkreten Aufnahme des Anderen Rechnung“ tragen würde. „Die Antwort auf die Infragestellung durch den Anderen bliebe damit in Lévinas‘ Philosophie gleichsam aus, weil die ethische Verantwortung für den unendlichen, unbedingten Anspruch des Anderen, in der endlichen Politik nicht rein gewahrt bleiben könne und Gastfreundschaft als reale Aufnahme daher nicht rechtlich institutionalisierbar sei“ (118). Sie verbleibe also auf einer ethischen Ebene und damit in einer „außerpolitischen Sphäre“. Gaßmann wirft Di Cesare vor, dass „die Konturen dessen, was sie mit Politik im allgemeinen und einem politischen Begriff von Gastfreundschaft im Speziellen meint, reichlich farblos und unspezifisch“ bleiben; denn „abgesehen von einer emphatischen Einforderung der Aufnahme und einer das Zusammenwohnen mit Fremden ermöglichenden Politik, gibt PM (i.e. Philosophie der Migration) wenig Orientierung, welche kritischen Maßstäbe für die konkrete Umsetzung der Aufnahme die Philosophie bereitstellen könnte“ (ebd.). Im Folgenden referiert der Beitrag zentrale Stellen aus Lévinas‘ Hauptwerken Totalität und Unendlichkeit und Jenseits des Seins, um Di Cesares Interpretation zu widerlegen. In ihrer Replik antwortet sie: „Meine Kritik des Souveränismus wäre undenkbar ohne die Reflexion von Lévinas auf das souveräne Ego, das den Anderen eliminiert – bis hin zu Auschwitz. Ich habe nie behauptet, dass das Denken von Lévinas oder das von Derrida unpolitisch wäre“ (207). In seinem letzten Abschnitt aber verfällt Gaßmann selbst dann doch in den sattsam bekannten Politiker-Sound, wenn er etwa die Forderungen nach Integration („keine Abwertung von Andersheit“), Institutionen, Grenzen und Schranken sowie Rechte und Pflichten verteidigt.
Naika Foroutan (Berlin) erörtert die Ambivalenz der Hospitalität in postmigrantischen Gesellschaften und fragt: „Wem gebührt die Gastfreundschaft und wer hat das Recht, sie zu gewähren?“ Ihr Ausgangspunkt sind vor allem Ergebnisse empirischer Forschung. „Die postmigrantische Gesellschaft ist von zurückliegender und aktueller Zuwanderung eines Teils der Bevölkerung geprägt und Migration ist politisch als konstitutiver Bestandteil der Gesellschaftsordnung anerkannt – auch wenn die Einstellungen eines relevanten Teils der Bevölkerung dazu negativ sein mögen“ (131). Im Ausgang von dieser Definition wird die konkrete Spaltung der Gesellschaft „in jene, die mit Pluralität, Hybridität und Ambivalenzen umgehen können, und jene, die sich dadurch verunsichert fühlen oder diese radikal ablehnen“, beschrieben. Auch Migranten der zweiten oder dritten Generation, die sich selber inzwischen zur „ursprünglichen“ Bevölkerung zählen, können ihre vermeinten „Privilegien“ durch Neuankömmlinge bedroht sehen. Mit einer solchen „zunehmenden demographischen und generationalen Heterogenität pluralisieren und hybridisieren“ sich Herkünfte, was „postmigrantische Aushandlungen“ (132), damit aber auch das Versprechen der Gleichheit erschwert, da immer mehr Gruppen das Recht der Gleichheit beanspruchen. „Migration ist dabei zu einer Chiffre geworden, in der die Abwehrphantasien kulminieren“ (139). Wenn die Nachfahren von Migranten selber den Anspruch erheben, „zu entscheiden, wer willkommen ist und wer nicht“, dann wird „die Idee der Hospitalität zunehmend unschärfer“ (148). Foroutans Fazit, dass die Migranten damit „auf eine zukünftige Art des Zusammenwohnens“ zeigen, die (Di Cesares Denken entsprechend) „nicht im Bann der Verwurzelung verbleibt, sondern in der Öffnung einer vom Besitz des Territoriums befreiten Bürgerschaft und einer Gastfreundschaft existiert“ (148), scheint eher ein Wunschdenken als in empirischer Analyse fundiert zu sein.
Regina Polack (Wien) überlegt, in welcher Weise Di Cesares Philosophie mögliche Anschlüsse für die praktische Theologie, d.h. für ihre Arbeit als Pastoraltheologin bereithält. Das vielfältige konkrete historische Versagen des Christentums im Umgang mit Fremden, z.B. eroberten Völkern, nennt sie „Schmerzpunkte für die deutschsprachige Theologie“, die es zu erkennen gilt und zu einer Umkehr nötigen. Einigermaßen seltsam mutet ihre Frage an: „Haben wir das gemeinsame Wohnen auf der Erde verlernt, das Di Cesare so eindringlich beschreibt …?“ Denn die Rückfrage würde lauten: Haben wir (wer immer das ist) es denn jemals gekonnt? In der alltäglichen Arbeit in der christlichen Gemeinde jedenfalls muss die Theologin auch bei nur kleinen Schritten in Richtung der Anerkennung von Migranten-Rechten „auf die Perspektive der Sesshaften Rücksicht nehmen“ (194), um überhaupt Gehör zu finden. „Politisch sind Di Cesares Forderungen derzeit in Europa schlicht und ergreifend nicht realisierbar“ (195).
Isabella Bruckner (Rom) sucht zu Di Cesares Migrationsphilosophie biblisch-christliche Ressourcen europäischer Gastlichkeit, sind doch die Erzählungen im Alten und Neuen Testament voll mit den Themen der Fremdheit, der (Nicht-)Zugehörigkeit, der Wanderung und der Gastlichkeit, und in all ihrer Fülle hilfreiche und notwendige Interpretamente, die implizit deutlich machen, was einer analytisch-philosophischen Auseinandersetzung mit dem Thema und ihrem letztendlich immer utilitaristischen Bezug für ein echtes Verständnis mit der Problematik fehlt. Neben den vielen etymologischen Verweisen werden natürlich die (bekannten oder weniger bekannten) relevanten Textstellen genannt, „Erzählungen des Fluchs, wo die Gastfreundschaft den Fremden verweigert oder sie sogar gewaltsam missbraucht wird“ (178), das christliche Gleichnis vom barmherzigen Samariter, oder der Spruch Gottes als Weltenrichter am Ende der Zeit, der in Matthäus 25,34 die Aufnahme des Fremden als das entscheidende Kriterium für die Trennung der Erlösten von den Verfluchten benennt, was Bruckner aber nicht wörtlich zitiert. („Geht weg von mir ihr Verfluchten, … denn ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen.“) Leser, denen alles Theologische suspekt ist, können diese eschatologische Trennung als Metapher für die Unterscheidung von gelingendem und misslingendem Leben im Diesseits interpretieren. Am wichtigsten in dieser theologisch-phänomenologischen Herangehensweise ist aber wohl, „dass Gott selbst der Fremde/Gast ist“ (177). Zum Beispiel in der Erzählung von Abraham und den drei Fremden. Auch auf die Bedeutung der Gastlichkeit in der von Benedikt von Nursia und seinen Regeln begründeten Gemeinschaft der klösterlichen Lebensform geht Bruckner ausführlich ein.
Der nicht zu übersehende Unterschied zwischen Di Cesares phänomenologischer Philosophie und der analytischen Philosophie (den, wie erwähnt, auch Hetzel und Malerba hervorheben) wird von Di Cesare selbst ausdrücklich thematisiert, nämlich in ihrer entrüsteten Replik auf einen Gedanken Judith Kohlenbergers, die gegen Ende ihres Aufsatzes schreibt: „Di Cesares Konzept des ‚Zusammenwohnens‘ erinnert in seiner gleichzeitigen Schlichtheit wie Radikalität an das Gedankenexperiment des Schweizer Philosophen Andreas Cassee, das wiederum auf den ‚Schleier des Nichtwissens‘ von John Rawls zurückgeht.“ Cassee fragt in seinem Essay Globale Bewegungsfreiheit (2016) so ähnlich wie Rawls in seiner Theorie der Gerechtigkeit: „Auf welche Grundsätze für den Umgang mit internationaler Migration würden wir uns einigen, wenn wir nicht wüssten, welche Staatsangehörigkeit wir besitzen, welcher sozialen Schicht wir angehören und welche Vorstellung von einem gelingenden Leben wir verfolgen?“ (159) Wenn man so einen hypothetischen Moment vor der eigenen Geburt imaginiert, kann man eine Antwort geben auf die Fragen, „welche Einwanderungsgesetze, welche Grenzkontrollen (und deren Durchsetzung), welche Form der humanitären Aufnahme (und Höhe der Kontingente), welches internationalisierte Passsystem würden wir uns wünschen?“ (ebd.) Das sog. „Gedankenexperiment“ läuft also schlicht darauf hinaus, sich in einen an einer europäischen Grenze zurückgewiesenen afrikanischen Flüchtling, der gerade dem Ertrinken im Mittelmeer zufällig entronnen ist, hineinzuversetzen. Aber genau diese Empathie wird ja von den europäischen Politikern (und den meisten Bürgern) bekanntlich massiv abgelehnt. Di Cesares Einwand lautet: „Schon aufgrund meines philosophischen Hintergrunds habe ich mich nie des Instrumentariums eines Gedankenexperiments bedient, ein Verfahren, das bekanntlich im Denken analytischer Prägung verbreitet ist und das ich wegen seiner heillosen ethischen Konsequenzen heftig kritisiert habe – sowohl in Philosophie der Migration (gerade mit Bezug auf Rawls) als auch beispielsweise in Folter (2023). Jenseits dieser methodischen Notiz fällt bei diesem Urteil jedoch das grundsätzliche Missverständnis gerade bezüglich eines so heiklen und komplexen Themas in die Augen“ (216). Was die analytischen Moralphilosophen, die sich so gerne auf „unsere Intuitionen“ (z.B. Harry G. Frankfurt: „our moral intuitions“) verlassen, nicht begreifen wollen, ist, dass diese Intuitionen (wie Nida Rümelins Buch Über Grenzen denken unfreiwillig bestätigt) immer schon von den bestehenden (herrschenden) Verhältnissen und jahrhundertealten egoistischen Praktiken geprägt sind, deren Legitimität erst aufzuweisen die Aufgabe der Moralphilosophie wäre; kurzum: dass sie einem von ihnen nicht erkannten Zirkelschluss das Wort reden. (Unsere Intuition: Dass nur ich bestimme, wer außer mir in meiner Wohnung oder meinem Haus wohnen darf, ist doch selbstverständlich. Analog bestimmen wir, wer in unser Land kommen darf. Olaf Scholz: „Wir dürfen uns aussuchen, wer zu uns kommen darf und wer nicht.“) Nicht zuletzt in dieser scharfen Abgrenzung von einem sowohl in philosophischer als auch ethischer Hinsicht desaströsen Denken wird mit dem Buch das von Dausner in der Einleitung gesetzte Ziel erreicht, Di Cesares innovative Philosophie der Migration in einem umfassenderen Kontext darzustellen. Und es wird deutlich, wie notwendig in einer sich immer stärker abschottenden „Festung Europa“ die Auseinandersetzung mit ihr ist.