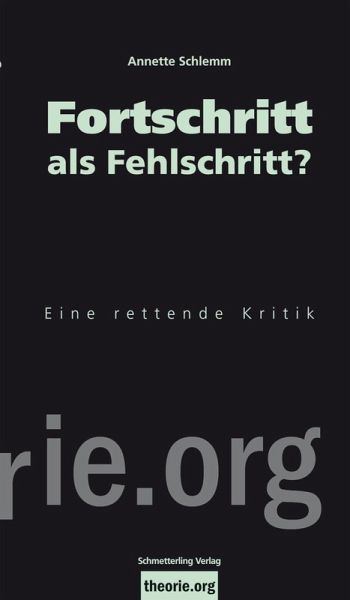Annette Schlemm
Fortschritt als Fehlschritt?
Pb., 203 Seiten, 15.- €
Stuttgart 2025 (Schmetterling-Verlag)
von Konrad Lotter
Wer gegenwärtig von „Fortschritt“ redet, assoziiert damit oftmals eine Bewegung hin zum Schlechteren: die beängstigende Auflösung demokratischer Prinzipien zugunsten autokratischer Willkür, die zunehmende Unverbindlichkeit des (Völker)-Rechts, die wachsende Überschuldung der Staaten bei massiver Aufrüstung und Militarisierung des Lebens, die ungebremste Veränderung des Klimas etc. „Fortschritt“ wird als als Gefahr empfunden, als Niedergang und Auflösung, der man sich mit aller Kraft entgegenstellen sollte.
Ganz anders der Blickwinkel von Annette Schlemm, Physikerin und Philosophin, die noch in der DDR aufgewachsen ist und, ihrer real-sozialistischen Erziehung entsprechend, „Fortschritt“ mit Hoffnung und der Vision einer besseren Welt verbunden hat. Von dieser Erziehung hat sie sich allerdings längst emanzipiert und, wie sie schreibt, ihr „früheres Weltbild dekonstruiert“. Was bei aller Dekonstruktion dieses (staatlich vereinnahmten) Konzepts allerdings überlebt hat, ist die Faszination, die von den verschiedenen Idealvorstellungen ausgeht, auf die sich der Fortschritt zubewegen soll: die Vorstellungen einer Welt ohne Knechtschaft und Elend, ohne Krieg, Unrecht und Entfremdung. Zugleich mit diesen Hoffnungen behält Annette Schlemm aber auch die Schranken dieser Idealvorstellungen im Auge. Auf der einen Seite analysiert und vergleicht sie die Strukturelemente, die den verschiedenen Fortschrittsbegriffen zugrundeliegen, auf der anderen Seite referiert sie die Diskussionen und Kritiken, die sich an diese Begriffe angeschlossen haben. Aufgrund ihrer großen Belesenheit (die neben philosophischen Texten auch literarische Texte umfasst) und der damit verbundenen weiten Perspektive gelangt Annette Schlemm dabei zu sehr differenzierten Aussagen. Am Ende ihres Buches versucht sie sich an einer „rettenden Kritik“, die den Begriff des Fortschritts bei aller „Kontaminierung“ doch aufheben und als Orientierung für soziale und politische Ereignisse beibehalten möchte.
Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt von Fortschritt gesprochen werden kann, ist ein entsprechendes „Zeitregime“, das von ökonomischen und kulturellen Bedingungen abhängt. Solange Zeit als stehendes Jetzt, als Wiederkehr des Gleichen oder als ein dem Wechsel der Jahreszeiten entsprechender Kreislauf erfahren wird, kann sich keine Vorstellung von Fortschritt ausbilden. Dazu bedarf es eines Zieles, wie etwa die Wiederkehr Christi und der Beginn des Tausendjährigen Reiches, auf das sich nach christlicher Auffassung die Geschichte in linearer Bewegung zubewegt. Während der Aufklärung verbreiteten sich dagegen säkulare Zielvorstellungen: die Überwindung des Naturzustandes durch den Gesellschaftsvertrag (Hobbes), der „ewige Frieden“ (Kant), das allgemeine „Bewusstsein der Freiheit“ (Hegel), die Aufhebung des bürgerlichen Privateigentums (Marx), die Emanzipation der Frau (Göttner-Abendroth) oder der Frieden mit der Natur. Ein wesentlicher Unterschied ist dabei, ob das Ziel positiv, als Annäherung an das angestrebte Ziel, formuliert wird, oder negativ, als fortschreitende Entfernung von einem bedrückenden Zustand, so wie Marx und Engels etwa den Kommunismus als „die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen [schlechten] Zustand aufhebt“ definierten.
Grundlegende Differenzen zwischen den verschiedenen Fortschrittskonzeptionen bestehen auch hinsichtlich der Frage, auf welche Weise der Fortschritt zustandekommt: als bewusster Akt handelnder Menschen (wie etwa bei der Verkündigung der Menschenrechte), als „Naturgesetz“ bzw. die Vorsehung eines weisen Schöpfers (wodurch das „ungesellige Wesen“ des Menschen die Vervollkommnung der Menschheit vorantreibt), als „List der Vernunft“ (die sich als Resultante widersprechender Handlungen und Zielsetzungen hinter dem Rücken der Menschen durchsetzt) oder als Zwang (wie beim Fortschritt der Technik, der sich aus der Konkurrenz der Kapitalisten bei Strafe des Untergangs ergibt). Einen wichtigen Autor mit seinem unter heutigen Verhältnissen skurril anmutenen Gottvertrauen hat sich Annette Schlemm bei der Diskussion dieses Themas allerdings entgehen lassen. Für Alexis de Tocequille ist der unausweichliche Fortschritt zur Demokratie durch göttlichen Willen gewährleistet, der sich der Menschen als „blinder Werkzeuge“ bedient. Zu diesen Werkzeugen gehören, wie er schreibt, nicht nur diejenigen, die sich für die Demokratie einsetzen, sondern (und ganz besonders) auch diejenigen, die sie bekämpfen. Donald Trump wäre, so gesehen, das blinde Werkzeug Gottes für den Fortschritt der Demokratie in Amerika, in der die Politiker dann nicht mehr käuflich sind und ihre Politik nach den Interessen derjenigen ausrichten, die ihren Wahlkampf durch großzügige Spenden finanzieren.
In eigenen Abschnitten behandelt Annette Schlemm die Fortschrittsbegriffe von Marx und Darwin, die bei aller Verschiedenheit das Gemeinsame haben, dass sie den Fortschritt post festum darstellen. Erst nachdem das Ziel (die kapitalistische Produktionsweise bzw. der homo sapiens) erreicht war, wird rückblickend nach den Bedingungen und den Etappen gefragt, über die dieses Ziel fortschreitend tatsächlich erreicht wurde. „In der Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen“, erst vom fortgeschrittenen Stadium einer Entwicklung können die Stadien begriffen werden, die ihm geschichtlich vorausliegen. Der zitierte Satz stammt nicht von Darwin, sondern von Marx.
Ein grundlegendes Problem des „Fortschritts“, das ausführlich zur Sprache gebracht wird, ist die Ungleichzeitigkeit, mit der sich verschiedene Bereiche der Gesellschaft entwickeln (wie etwa die Kunst, die unter zurückgebliebenen ökonomischen Verhältnissen ein Höchstmaß an Vollkommenheit erreicht hat) und, mehr noch, die gegenläufige Entwicklung verschiedener Bereiche, für die sich viele Beispiele anführen lassen. Mit dem Anwachsen des gesellschaftlichen Reichtums etwa wächst auch die Spaltung der Gesellschaft und die Verbreitung relativer Armut; die wachsende Herrschaft über die Natur geht mit der Ohnmacht gegenüber dem fortschreitenden Klimawandel einher. An diese Überlegungen schließt sich reibungslos die Kritik an den verschiedenen Konzepten des „Fortschritts“ an: wenn etwa die ungewollten „Nebenwirkungen“ die gewollten Ziele übersteigen und konterkarieren. Ausführlich referiert Annette Schlemm die Kritik am Fortschritt, die schon von Oswald Spengler oder Ludwig Klages (in reaktionärer Weise mit Richtung auf die Erhaltung des status quo), in reflektierterer Form dagegen von Walter Benjamin (der die unter der Sozialdemokratie verbreitete Annahme, man schwimme „in Strom“ des automatischen Fortschritts, anprangert) oder den Autoren der Dialektik der Aufklärung (die der Entzauberung der Welt das „triumphale Unheil“ der vollends aufgeklärten Welt entgegensetzen) vorgetragen wurde. Schon Ernst Bloch kritisierte den verbreiteten Eurozentrismus der meisten Fortschrittstheorien, als wäre die europäische Zivilisation das Maß und Ziel, auf das sich alle anderen Erdteile und Kulturen zubewegen sollten.
Am Ende ihres lesenswerten Buches widmet sich Annette Schlemm einer „rettenden Kritk“ des Fortschrittsbegriffes, die sie in einer Reihe von Thesen vorträgt. Wer sich grundsätzlich gegen Fortschritt ausspricht, meint offenbar, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Manche, wie der Fürst von Salina, meinen allerdings auch, dass sich vieles ändern muss, damit alles beim Alten bleibt. Worauf es beim „Fortschritt“ ankommt, sind die Ziele und die darin zum Ausdruck kommenden Interessen. Ohne solche Zielvorstellungen exitiert keine Orientierung, weder für die Beurteilung von politischen oder sozialen Ereignissen, noch für das eigene Handeln. Auch wenn sich der Begriff des Fortschritts nicht mehr auf die Gesellschaft als ganzer, sondern nur noch auf Teilbereiche bezieht, ist er doch letztlich auf Emanzipation, das heißt auf die Freiheit und deren Verwirklichung gerichtet: auf die Befreiung von Not und Unwissenheit, von Knechtschaft, Krieg, Ausbeutung und Angst.