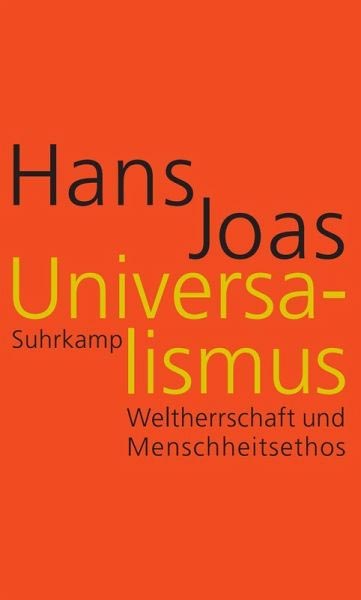Hans Joas
Universalismus
Weltherrschaft und Menschheitsethos
geb., 975 Seiten, 48,- €
Suhrkamp-Verlag, Berlin 2025
von Robert Lembke
Will, wer Menschheit sagt, betrügen, wie einst Carl Schmitt insuinierte? Nicht, wenn es nach Hans Joas geht: Ganze 900 Seiten widmet der Soziologe mit dem theologischen Profil einer Analyse dessen, was er „moralischen Universalismus“ nennt: Das Bewusstsein dafür, dass allen Menschen ein unhintergehbarer Wert zukommt, auch jenseits der eigenen Gruppe und unabhängig von Interessen und Situationen.
Nicht unbedingt erleichtert wird das Verständnis dadurch, dass das gewichtige Buch den Abschluss einer Trilogie bildet: Hatte Joas im ersten Band nach der „Macht des Heiligen“ gefragt und – der gängigen These einer unumkehrbaren Säkularisierung entgegentretend – ihre vielfältigen Transformationen in der Moderne aufgesucht, bezog er sich im zweiten Band, „Im Bannkreis der Freiheit“, kritisch sowohl auf Hegel als auch auf Nietzsche und versuchte, ein alternatives Religionsverständnis zu entwickeln, das um den Begriff der „Selbsttranszendenz“ und seine ethischen Implikationen kreist.
Im dritten Band nun sind für Joas die Quellen des moralischen Universalismus untrennbar mit der „Achsenzeit“ (800 v. Chr. bis 200 n. Chr.) verbunden. Mit Karl Jaspers, Robert Bellah und anderen sieht er in diesem langen geschichtlichen Zeitraum erstmals ein Menschheitsethos aufscheinen, dessen vielfältige Ausdrucksformen und Wandlungen die weitere Geschichte mitbestimmt haben. Die moralischen Universalismen in Indien, China, dem antiken Griechenland und im Judentum seien eine „kontingente schöpferische Reaktion“ (81) auf den Eroberungs- und Anpassungsdruck antiker Imperien gewesen – wobei sich hier relativ zu Beginn die interessante Pointe ergibt, dass sich drei davon, nämlich der indische, jüdische und griechische moralische Universalismus, der Expansion des antiken persischen Weltreichs „verdanken“. Damit ist zugleich auch der weltgeschichtliche Gegenspieler des Menschheitsethos benannt – der „politische Universalismus“ machthungriger Staaten, die stets bestrebt sind, ihren Herrschaftsbereich zu vergrößern und der eigenen Weltanschauung notfalls mit Gewalt Geltung zu verschaffen.
Die Quellen des moralischen Universalismus werden zunächst aufgesucht in der jüdischen Prophetie, im antiken Griechenland – weniger in Demokratie (nicht konsequent implementiert) und Philosophie (Platon und, etwas überraschend, Aristoteles kommen sehr schlecht weg) als vielmehr in der Tragödie, die Joas allerdings an einem einzigen Werk, Aischylos’ „Die Perser“, exemplifiziert – sowie in Indien (Buddhismus) und China (Konfuzianismus). Schon hier ist Joas’ Bemühen um eine Abkehr vom Eurozentrismus zu verspüren, die ebenso wie seine immer wiederkehrende Auseinandersetzung mit postkolonialen Argumenten sicherlich positiv zu bewerten ist.
Charakteristisch für seine Arbeit ist außerdem der methodische Ansatz, seine eigenen Gedanken über weite Strecken in Abgrenzung und Vergleich mit den Soziologen Max Weber und Ernst Troeltsch zu entwickeln – ein m.E. nicht immer nur produktives Vorgehen, das das Buch teilweise unnötig verlängert, gerade wenn man sich die teils harsche Kritik an den Autoren (mehr an Weber als an Troeltsch) vor Augen führt. Hier wie fast durchgehend zeigt sich Joas jedoch vor allem als stark vom akademischen Umfeld geprägter, skrupulös-relativistischer Denker, der neben stupender Gelehrsamkeit auch mit immensem philologischen Eifer aufwartet – da werden ein ums andere Mal handschriftliche Anmerkungen in abseitigen Werken beigebracht, und es wäre ohne Weiteres möglich, eine Liste von 20 Autoren anzuführen, deren Namen auch Diskursteilnehmern kaum bekannt sein dürften, denen Joas jedoch entscheidende Impulse zuspricht.
Zurück zur Argumentation: Von Anfang an steht der moralische Universalismus unter dem Druck politischer Mächte; in Indien kann der Buddhismus niemals wirklich Fuß fassen und wandert aus, der Konfuzianismus ist der Sonderfall einer „konfessionslosen“, d.h. nicht institutionalisierten und mit anderen Einflüssen teilweise bis zur Unkenntlichkeit sich vermischenden, Religion ohne Kirche, und das geschichtliche Schicksal des Judentums ist weithin bekannt. Umso interessanter muss in der Rückschau der Sonderfall des Christentums erscheinen, das – vermittelt über Paulus als zentrale Figur – eine „Fusion seines religiös-moralischen Universalismus mit dem politischen Universalismus des Imperiums“ (271) zustande brachte und dieses Imperium, das römische, bekanntlich sogar überlebte.
Die wechselvolle Geschichte des Verhältnisses von christlicher (Staats)Religion und den Nachfolgeregimen Roms, wie sie Joas rekonstruiert, kann hier nicht nachgezeichnet werden. Ausdrücklich seien jedoch die diffizilen Kapitel zu Augustinus, zum Dualismus von weltlicher und geistlicher Macht oder zur sogenannten organischen Sozialethik, gipfelnd in Dantes utopischer Vision einer christlichen Universalmonarchie, dem geschichtlich und philosophisch interessierten Leser zur Lektüre empfohlen – Joas befindet sich hier offenbar auf ureigenstem Terrain und kann mit einer Fülle interessanter Befunde und Einsichten aufwarten, immer akribisch situiert und eingeordnet in den diskursiven Strom aktueller Forschung und Diskussion. Ein Beispiel sei trotzdem angeführt, nämlich die Beschreibung der Art und Weise, wie das Christentum in der Eucharistiefeier die archaische Praxis des Opfers (von Menschen, Tieren oder Dingen) in einer Weise transformiert, die an Hegels dialektische „Aufhebung“ erinnert: ein Prozess, in dem eine Sache zugleich beendet, erhöht und bewahrt wird.
Mit dem Ende des Mittelalters entsteht ein zweiter Strang des moralischen Universalismus, der aus den Naturrechtsdebatten des Mittelalters hervorgehende Menschenrechtsdiskurs. Als zentrale Figur macht Joas den Dominikaner Bartolomé de Las Casas aus, der, selber anfänglich spanischer Kolonialist im neu „entdeckten“ Amerika, sich mehr und mehr gegen die Gewalt an und Ausbeutung der indigenen Bevölkerung wendet: „In den folgenden Jahren verstärkte sich bei ihm die Identifikation der Indios mit dem gequälten und gekreuzigten Christus gemäß dessen Lehre, ihn jederzeit in den Geringsten unter den Mitmenschen zu sehen“ (460). Freilich bleibt Las Casas’ lebenslanges Engagement weitgehend folgenlos, wie sowohl er selbst als auch Joas keineswegs leugnen – wohl aber nicht vollkommen wirkungslos: Denn von hier führt eine Linie über Zwischenstationen zu den Menschenrechtserklärungen der Amerikanischen und Französischen Revolution, die in ihrer Interdependenz sowie im Zusammenhang mit den Weltgeschehnissen genauestens analysiert werden. Dabei setzt sich Joas immer wieder in bewundernswerter Weise mit der postkolonialistischen Frage auseinander, ob denn nicht diese angeblich universalen Menschenrechte angesichts ihrer unauflöslichen Verstrickung mit dem Kolonialismus – dem nach Dauer und Opferzahl wohl größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte – nicht wertlos seien; oder schlimmer noch, ob sie als ‚Feigenblatt‘ des politischen Universalismus (Joas vermeidet den Begriff „Imperialismus“ wegen dessen Engführung bei Lenin) nicht sogar gegenteiligen Zielen dienten. Joas arbeitet sich an dieser Frage sehr intensiv ab, verneint sie jedoch letztlich.
Weniger überzeugen kann Joas‘ Auseinandersetzung mit der Moderne. Die Aufklärung und die mit ihr verbundene Zurückdrängung religiöser Prägungen und Vorstellungswelten zeichnet er als europäischen Sonderweg, der „in hohem Maße kontingent“ (525) gewesen sei. Über die wesentlichen Treiber dieser Entwicklung, nämlich (Natur)Wissenschaft und Technik, redet Joas freilich nicht. Stattdessen betont er, dass sich jede moralische und rechtliche Hochschätzung des einzelnen Menschen als Individuum religiösen Quellen verdankt („Sakralität der Person“) – jedoch sozusagen mit dem Geburtsfehler, dass Angehörige bestimmter subalterner Gruppen in so gut wie allen Kulturen gar nicht erst als Individuen in den Blick kommen: „Wir müssen deshalb dem Sachverhalt ins Auge sehen, daß der menschheitsgeschichtliche Fortschritt hin zu einer rechtlichen Kodifikation moralisch-universalistischer Forderungen selbst im Akt dieser Positivierung mit neuen Formen der Einschränkung dieses Universalismus verbunden war“ (549). Hatte Schmitt – „wer Menschheit sagt, will betrügen“ – also doch recht?
Damit sind wir im Prinzip in der Gegenwart angekommen. In relativ geschlossenen Einzelkapiteln widmet sich Joas gewohnt detail- und kenntnisreich dem Faschismus (als direkter Negation jedes moralischen Universalismus), der Bürgerrechtsbewegung in den USA, dem indischen Unabhängigkeitskampf und dabei insbesondere Gandhi, Mao Zedong (und dem Maoismus als radikalster Form eines antireligiösen Universalismus) sowie dem Islam.
Das alles kann hier nicht nachgezeichnet werden, sei aber zur Lektüre wiederum ausdrücklich empfohlen. Drei Aspekte möchte ich hier herausheben: Erstens die lehrreiche Pointe, dass die „Allgemeine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ von 1948 als direkte Reaktion auf die Erfahrung des Faschismus zu verstehen ist; und dass sie keineswegs „ein westliches Oktroi“ (606) darstellt, wie Joas brillant herausarbeitet. Im Gegenteil geht der Wortlaut im Wesentlichen zurück auf den libanesischen Politiker und Intellektuellen Charles Malik (1906-1987) und den chinesischen Philosophen und Kosmopoliten Peng-chun Chang (1897-1957). Zweitens die Rolle von Mahatma Gandhi, der mit seiner Lehre der „ahimsa“ (Gewaltlosigkeit) und den damit verbundenen Formen des Widerstands sozusagen zum prototypischen Helden von Joas’ moralischem Universalismus wird – und übrigens als Vorbild und Ideengeber die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und Martin Luther King stark beeinflusste. Und drittens die staunenswerte Perspektivierung und Rehabilitierung des Islam, der – mit Unterstützung des amerikanischen (!) Religionshistorikers Marshall Hodgson (1922-1968) – von Joas sozusagen in den weltgeschichtlichen Strom des moralischen Universalismus, nun auch „interreligiöser Universalismus“ genannt, eingemeindet wird.
Bei aller Bemühung um die Verdienste des moralischen Universalismus, etwa die Hochschätzung von Augustinus, Dante oder Martin Luther King, kann man nicht übersehen, welch beschränktes Potenzial moralische Ideale für Joas letztlich haben. Ihr geschichtlicher Aufschwung ist zeitlich und räumlich begrenzt und verdankt sich einmaligen Konstellationen sowie besonderen Individuen, die ihre schöpferische Leistung auffällig oft mit dem gewaltsamen Tod bezahlen. (Man kann daher kritisch fragen, woher die heutigen bedrängten Individuen die Inspiration und Kraft zu solch hochfliegenden und persönlich riskanten Aufschwüngen überhaupt nehmen sollen.) Zudem hat die Geschichte in Joas’ Sicht, jedenfalls in Europa, eine falsche Abzweigung, die des Säkularismus, genommen, an dessen diskursiver Korrektur er als Autor nun tatkräftig mitwirkt – stellenweise liest sich sein Text denn auch wie die Einlösung von Habermas’ Anfang der 2000er Jahre ausgerufener „postsäkularer Wende“ mit ihrem Aufruf zur Revitalisierung religiöser Sinnbestände.
Wenn man sich die aktuellen kulturkämpferischen Frontlinien anschaut, wie sie zum Beispiel in den USA verlaufen – Stichwort MAGA, Wissenschaftsfeindschaft und Deliberalisierung –, kann man große Zweifel haben, ob diese Intervention, so verdienstvoll sie ist, in die richtige Richtung weist. Die Rückkehr zu wie immer gewandelten Traditionsbeständen – ganz im Sinne von Malrauxs angeblichem Diktum: „Das 21. Jahrhundert wird religiös sein oder es wird nicht sein“ – führt nicht selten zu politischen Ideologien, die einmal erreichte zivilisatorische Fortschritte und Freiheitsrechte fröhlich und rücksichtslos missachten. Zudem wäre, selbst wenn es gelänge, sich auf Weltebene auf einen allgemein akzeptierten Satz universeller moralischer Normen zu einigen, noch die ganz praktische Frage zu klären, wie man sie – modern und ironisch gesprochen – in ‚Humankapital‘ implementiert‚ ohne die Zwangszivilisierung der Vergangenheit zu wiederholen.
Mir scheint Joas daher eher das Symptom einer Art utopischen Schließung zu sein, die das Schicksal der Menschheit ungewollt dem Voluntarismus und der Technologie in die Hände legt. Wenn es daraus offenbar kein Entrinnen gibt, bleibt nur, sich mit den Abziehbildern der Vergangenheit zu trösten – wie ohnehin Joas’ ganze Geschichte unrettbar vergangenheitsfixiert ist und die Gegenwart des 21. Jahrhunderts auch zum Ende hin kaum in den Blick bekommt. Es gibt ja auch Universalismen des Geldes, der Technologie, der Wissenschaft etc., die auch ihre Fürsprecher und Agenten haben, aber verdeckter operieren und sich um die Ideengeschichte wenig bis gar nicht scheren. Möglicherweise ist das Zeitalter der Moral – das zudem an das im Rückgang befindliche Medium der Schrift gebunden sein könnte – sogar schon zu Ende, und das Zeitalter des Bildes, der Codes und der Automatisierung hat längst begonnen.