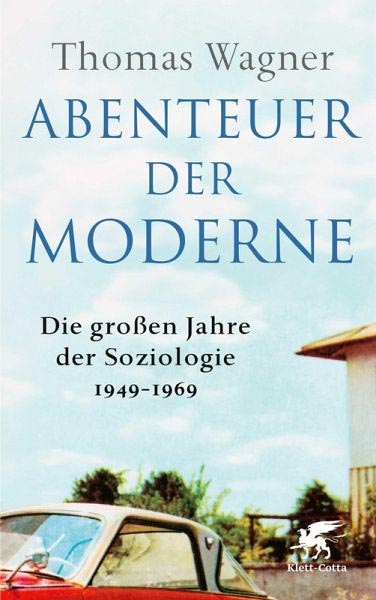Thomas Wagner
Abenteuer der Moderne
Die großen Jahre der Soziologie 1949–1969
geb., 330 Seiten, 28,- €
Stuttgart 2025, Klett-Cotta Verlag
von Konrad Lotter
Thomas Wagner erzählt die Geschichte der deutschen Nachkriegs-Soziologie als einen Prozess, der von Gegensätzen ausgeht, die sich innerhalb von 20 Jahren über verschiedene Stufen hinweg zunächst auflösen, wobei es zu gewissen Annäherungen, zu allen möglichen Formen der Zusammenarbeit und sogar zu persönlichen Freundschaften kommt. Am Ende der „großen Jahre“ allerdings brechen, wie er weitererzählt, die alten Gegensätze unter veränderten Verhältnissen und in veränderter Form wieder auf. Im Zentrum des Buches steht dabei die Beziehung von Th. W. Adorno als Repräsentant der 1949 aus der Emigration zurückgekehrten Antifaschisten und Arnold Gehlen, der 1933 das „Bekenntnis deutscher Professoren zu Adolf Hitler“ unterschrieben und während des „Dritten Reiches“ eine „Traumkarriere“ gemacht hatte.
Eine erste „Begegnung“ der beiden fand bereits am Ende der Weimarer Republik statt. Adorno hatte sich bei dem religiösen Sozialisten Paul Tillich mit seiner Arbeit über Kierkegaard habilitiert. Tillich, der sich mit einer Kritik am aufkommenden Nationalsozialismus hervorgetan hatte, wurde sofort nach der „Machtergreifung“ aus dem Staatsdienst entlassen. Seine Professur erhielt vertretungsweise Gehlen. Wie seinem Lehrer war auch Adorno die Universitätskarriere versperrt, er emigrierte zuerst nach England, dann in die USA. Gehlen wurde dagegen auf den Lehrstuhl seines ebenfalls entlassenen jüdischen Doktorvaters Hans Driesch in Leipzig berufen, später auf den Kant-Lehrstuhl in Königsberg und zuletzt an die Universität in Wien.
Von den acht Lehrstühlen für Soziologie, die 1949 nach dem Ende der Diktatur ihre Arbeit aufnahmen, waren drei von zurückgekehrten Emigranten oder ausgewiesenen Gegnern des Nationalsozialismus (Max Horkheimer, der zunächst von Adorno nur vertreten wurde, René König, Otto Stammer), drei von ehemaligen Nazis (Arnold Gehlen, Helmut Schelsky, Gerhard Mackenroth) besetzt, die nach kurzer „Entnazifizierung“ wieder eingestellt wurden und weiterlehren durften. Das gegenseitige Misstrauen war, wie Thomas Wagner berichtet, groß; beide Seiten fühlten sich voneinander ausspioniert. Schon Anfang der 50er Jahre allerdings, im Zuge der Adenauerschen Politik des Kalten Krieges, der Aufrüstung und der Frontstellung gegen Stalin und die Sowjetunion, die beide Seiten unterstützten, war der Boden ihrer Annäherung bereitet.
Noch überwog freilich die Feindschaft. Durch „vernichtende Gutachten“ verhinderten Horkheimer und Adorno die Berufung Gehlens nach Heidelberg. Adorno stützte sich dabei vor allem auf die Zuarbeit und das Urteil seines damaligen Assistenten Jürgen Habermas. Habermas hatte bei dem Faschisten Erich Rothacker, dem Organisator der „Bücherverbrennungen“ 1933, promoviert, hatte versucht, (in Fortführung der „Kritischen Theorie“) die Marxsche Theorie weiterzuentwickeln, stieß dabei aber auf die Ablehnung von Horkheimer, der sich von diesen Anfängen inzwischen entfernt hatte. In dessen Person zeigt Thomas Wagner die langsame Durchlässigkeit der Grenzen zwischen ehemaligen Faschisten und Antifaschisten. Horkheimer pflegte Kontakte nicht nur zu Adenauer, sondern auch zu dem Bankier Hermann Joseph Abs, der Himmler nahegestanden war, unterstützte (durch Gutachten) den „Parteigenossen“ Bruno Liebrucks und den Rasseforscher Karl Valentin Müller. Er versuchte sogar, die Nazi-Propagandistin Elisabeth Noelle-Neumann, die in der Nachkriegszeit als Demoskopin große Anerkennung fand, zur Mitarbeit im „Institut für Sozialforschung“ zu gewinnen. Habermasʼ marxistisch-orientierte Ablehnung von Gehlen (in dessen Soziologie seiner Ansicht nach „das gesamte Instrumentarium des Faschismus … beisammen“ ist) erscheint umso bemerkenswerter, als sie der ebenfalls marxistisch-orientierten Begeisterung für Gehlen von Seiten des philosophischen Jung-Stars aus der DDR, Wolfgang Harich, gerade entgegengesetzt ausfiel. Harich hielt Gehlens 1940 erschienenes Werk Der Mensch (in zweiter Auflage von Anpassungen an NS-Jargon und -Ideologie gereinigt) für eine Leistung, die für die systematische Ausarbeitung einer marxistischen Anthropologie unverzichtbar sei. Er suchte die Freundschaft Gehlens und setzte sich (vergebens) sogar dafür ein, ihn an die Ostberliner Humboldt-Universität zu berufen.
Eine Zäsur in der Beziehung zwischen Adorno und Gehlen bildete das Jahr 1960, in dem Gehlens Zeit-Bilder erschienen. Mit seinem Untertitel Zur Soziologie und Ästhetik der Moderne beinhaltete es ein Plädoyer für die abstrakte Malerei und überhaupt die Kunst der Avantgarde, in dem Adorno Übereinstimmungen mit seiner eigenen Kunstanschauung entdeckte. Es kam darüber gewissermaßen zu einem Bündnis nicht nur gegen den verbreiteten Publikumsgeschmack (der zu dieser Zeit der Ablehnung der „entarteten Kunst“ durch die Nazis noch ähnlich war), sondern auch gegen die reaktionäre Ablehnung der Avantgarde durch Hans Sedlmayr, der die Abkehr der Kunst von der Religion als Verlust der Mitte beklagte. Einig waren sich beide auch in der Ablehnung von Heidegger, dem „Yogi von Freiburg“ (Gehlen) und Schwadroneur des „Eigentlichkeit“ (Adorno). Dissens bestand dagegen in Bezug auf Hegel, von dem sich (nach Gehlens Ansicht) nichts mehr lernen ließ. Im Gegensatz zu Günter Anders oder René König, die mit dem ehemaligen Nazi nichts zu schaffen haben wollten, entwickelte sich zwischen Adorno und Gehlen eine gewisse Freundschaft mit privaten Essenseinladungen (samt Ehefrauen) und Ausflügen (in Gehlens VW).
Auf dieser Grundlage kam es zu den denkwürdigen „Streitgesprächen“, die 1964 /65 im Südwestfunk, späterhin auch im WDR-Fernsehen übertragen wurden. Unter Wahrung kollegialer Achtung stritt man zum einen über die Frage, ob sich im Deutschland der Nachkriegszeit eine „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ breitgemacht habe, für die die Marx‘sche Klassenanalyse nicht mehr greift (so Gehlen im Anschluss an Schelsky), oder die Gesellschaft weiterhin nur als Klassengesellschaft angemessen begriffen werden kann. Zum anderen stritt man über die Bedeutung gesellschaftlicher Institutionen, die von Menschen geschaffen, sich den Menschen gegenüber aber verselbständigt und Macht über sie gewonnen haben. Gehlen, der die Menschen als (biologische) „Mängelwesen“ dargestellt hatte, begriff die Institutionen als „Entlastung“, ohne die die Menschen innerhalb der Industriegesellschaft nicht überleben und sich entwickeln könnten. Freiheit sei nur innerhalb und unter der Voraussetzung und Akzeptanz der bestehenden Entfremdung möglich. Adorno betonte dagegen den repressiven Charakter der Institutionen, die den Menschen im Zustand der Unmündigkeit halte und forderte, die verselbständigten Institutionen wieder unter die Kontrolle der Menschen zu bringen.
Wagners Buch besticht durch seine weite Perspektive und seinen ungeheuren Detailreichtum. Es erzählt die Geschichte der Soziologie in ihrem Bezug auf die Kehrtwendungen und auch auf die Skandale der Politik (Spiegel-Affäre u.a.), auf die wachsende Bedeutung der Massenmedien für den wissenschaftlichen Diskurs und berücksichtigt nicht zuletzt die Biografien und Karrieren einzelner Soziologen. Eine eminente Rolle spielt darin selbstverständlich auch der wirtschaftliche Aufschwung des „Wirtschaftswunders“ und seine Auswirkungen auf die rasanten Veränderungen der Lebenswelt, was die Bedeutung der Soziologie steil ansteigen ließ. 1960 gab es nicht mehr nur 8, sondern bereits 25 Lehrstühle für Soziologie, die Zahl der Studenten an der Frankfurter Universität stieg von 60 (1955) auf 626 (1968). Bundesweit verdreifachte sich ihre Zahl von 1897 (WS 1963/64) auf 5593 (WS 1970/71). Soziologische Bücher wurden zu Bestsellern, zunächst noch mehr von Gehlen und Schelsky als von Adorno und Habermas. Von der Soziologie erwartete man Antworten auf die drängenden Fragen der Industriegesellschaft.
Hatten sich Adorno und Gehlen zunächst einander angenähert, miteinander diskutiert und partiell zusammengearbeitet, so brach im Zuge der Studentenrevolte die alte Feindschaft wieder auf. Dem 16. Kongress der „Deutschen Gesellschaft für Soziologie“ im April 1968 zum Thema Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft, der mit 1300 Teilnehmern in der Frankfurter Messehalle abgehalten wurde, blieb Gehlen fern. Während die Studenten neben den Klassikern des Marxismus zunehmend auch die Anarchisten (Bakunin, Kropotkin, Mühsam u.a.) lasen und praktisch-politische Konsequenzen daraus zogen, geriet der Konservative Gehlen, der sich zusammen mit anderen konservativen Professoren im „Marburger Manifest“ den Mitbestimmungs-Ansprüchen der Studenten widersetzte, zunehmend in die Isolation. Er warf dem „liberalen Halbmarxisten“ Adorno vor, die bis dahin überwiegend braven Studenten mit seinen utopischen Idealen zur Revolte angestachelt zu haben. Die Revolte richtete sich zuletzt allerdings auch gegen Adorno selbst, der, als das soziologische Institut von Studenten besetzt wurde, die Polizei zur Hilfe rief und seine Vorlesung abbrach, als er dafür zur „Rechenschaft“ gezogen und zur Entschuldigung aufgefordert wurde. Von den Krawallen gesundheitlich stark angeschlagen, verstarb Adorno im Sommer 1969.
Die „großen Jahre der Soziologie“ hatten, wie Thomas Wagner ergänzt, ein erfreuliches politisches Nachspiel. Bei der Bundestagswahl 1969 scheiterte die NPD, die bereits in verschiedenen Landesparlamenten gesessen hatte, an der 5%-Hürde. Der damalige Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, wie Gehlen ehemaliges Parteimitglied der NSDAP, verlor die Wahl. An seiner Stelle wurde Willy Brandt, der wie Adorno 1933 vor dem Nationalsozialismus geflohen und ins Exil gegangen war, zum Bundeskanzler gewählt.
Von großem Interesse sind zuletzt auch noch Wagners Schlussbemerkungen über die Rezeption Gehlens nach dem Ende der „großen Jahre“. Auf der einen Seite wurde Gehlen von den rechtsgerichteten Zeitschaften Criticon und Sezession als ein „unabgegoltener Denker“ entdeckt und dem Studium empfohlen. Mit seiner Propagierung staatlicher Ordnung und autoritärer Strukturen (wobei er zuletzt noch in der Sowjetunion ein Vorbild gesehen hatte) stieg Gehlen auf diesem Wege zum Vordenker der Neuen Rechten auf. Auf der anderen Seite wandte sich Wolfgang Harich, der langjährige Freund und Bewunderer Gehlens (der dessen Werke Georg Lukács und Bert Brecht dringend zum Studium empfohlen hatte) enttäuscht von ihm ab. Ab 1986 sieht er in ihm nur noch den Plagiator des jüdischen Mediziners und Anthropologen Paul Alsberg und dessen Buch Das Menschheitsrätsel (1922): einen Ganoven, der einem Verfolgten des Nazi-Regimes „den rationalen Kern seines Hauptwerkes gestohlen“ hat.