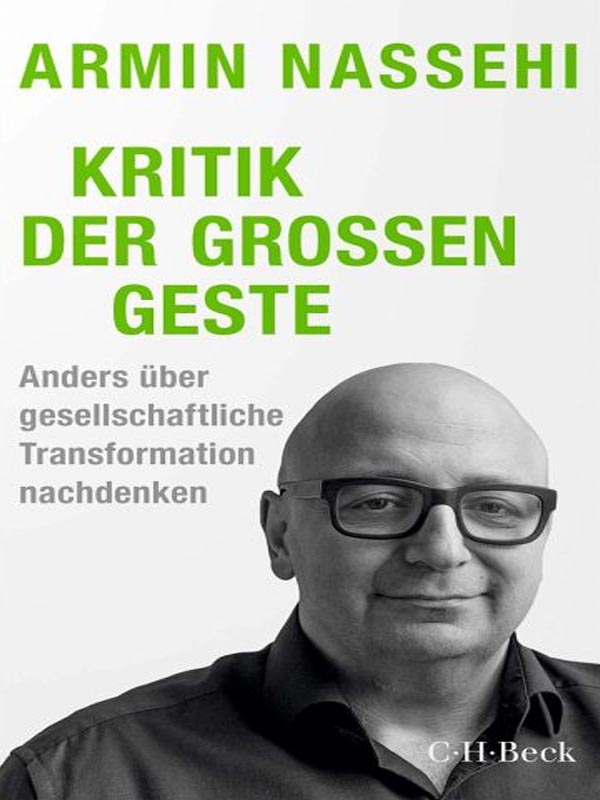Armin Nassehi
Kritik der großen Geste
Anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken
br., 224 Seiten, 18.-€,
München 2024 (Beck-Verlag)
von Bernd M. Malunat
„Kunst ist das Gegenteil von gut gemeint“ – dieses Bonmot des großen Spötters Gottfried Benn lässt sich auch auf das vorliegende Büchlein anwenden; denn es darf ja keine Zweifel daran aufkommen, dass der durchaus renommierte Münchner Soziologe es ernst meint. Nassehi will allerdings keinen wissenschaftlichen Text, auch kein politisches Buch vorlegen. Er verzichtet deshalb auf jeglichen wissenschaftlichen Apparat, begnügt sich mit gelegentlichem name dropping, um durch eine barrierefreie Form das Lesen und auch sein Schreiben zu erleichtern. Damit lässt sich der holprige Schreibstil aber nicht erklären, der den Eindruck erweckt, der Autor habe seinen Text einer Maschine anvertraut, doch irgendwie übersehen, ihn nach dem Ausdruck zu korrigieren. Da wäre ein engagierter Lektor hilfreich gewesen, nicht nur ein paar interessierte Freunde (8). Es handelt sich also um einen Essay (26), einen Versuch eben, der aber den Anspruch erhebt, das politische Problem zu lösen, wie multiple Krisen durch die „Kritik der großen Geste“ in den Griff zu bekommen sind (100). Dies vorauszuschicken ist nötig, weil sonst vieles dieser Schrift ganz eigener Art kaum verstehbar wäre.
Systeme, so Nassehi, seien stabiler, träger als ihre Umwelt (11), und diese Trägheit bilde einen strukturellen Schutzmechanismus (12), der sich trotz gediegenen Wissens und bester Absicht kaum ändern lasse, weil die innere Dynamik, die Selbstlimitation der Gesellschaft dem entgegenstehe (17). Die soziale Welt sei nicht aus einem Guss, könne daher auch nicht kollektiv handeln (172). Diese angenommene Absage an die kollektive Veränderbarkeit von Bedingungen gerinnt zu der Aussage, dass „nur die Mittel und Formen zur Verfügung (stehen), die auch wirklich zur Verfügung stehen“ (21). Nassehi hält dies tatsächlich für einen vielleicht wirklich revolutionären Satz (21)!, der vielleicht wirklich falsch ist. Jedenfalls erscheint ihm die Gesellschaft als zur Einsicht unfähig.
Da wir multiplen Krisen ausgesetzt seien, stelle sich „ernsthaft die Frage, ob die liberale Demokratie überhaupt dafür gerüstet ist, existentielle Herausforderungen zu bewältigen“ (63); mehr noch könne man „dann ernsthaft fragen, ob die Demokratie überhaupt für kollektive Krisenbewältigung in der Lage sein kann, und man wird die Frage ebenso verneinen müssen, wie man die Alternativen in Rechnung stellen muss“ (85), als die er „Indoktrinierung, Abschottung, Gewalt“ (85) ausmacht. Damit wendet sich der Autor aber keineswegs von der Demokratie ab, postuliert vielmehr – wenn auch in einer kontradiktorischen Wendung –, „dass die Krise der Demokratie allein durch kompetentere Politik überwunden werden kann“ (179), die durch die operative Durchsetzung konkreter Entscheidungen für nachhaltige Lösungen, die angemessene Wirkungen erzeugen, sorgen müsse (180).
Das bürgerliche Gesetz, das in den bisherigen Überlegungen begrifflich nicht vorkommt (43), erhält durch die implizierte Politiker-Schelte seine Funktion zwar zurück, wird allerdings gleich wieder einkassiert, weil man sich Problemlösungskompetenz zwar wünschen, nicht aber dekretieren könne (182). Seine grundlegende Skepsis gegenüber der Wirksamkeit des rechtsstaatlichen Gesetzes gilt selbst dann, wenn es sachlich überzeugend begründet und gut kommuniziert wird; denn „man kann kaum Empirisches verstehen, wenn man keinen ausgearbeiteten Gesellschaftsbegriff hat“ (208). Gibt es demnach also keine Verpflichtung, staatliche Gesetze zu befolgen? Anders: muss das Gesetz hinter den durchaus berechtigten Interessen einer diversen Gesellschaft zurücktreten, selbst wenn erkennbar ist, dass durch Untätigkeit Kosten entstehen werden, welche die Gesellschaft zu tragen haben wird? Ist das unvermeidbar oder schon fahrlässig? Das wirft die Frage nach der demokratischen Verfasstheit der Gesellschaft auf.
Über einen ausgearbeiteten Gesellschaftsbegriff verfügt für den Soziologen natürlich die Soziologie. Ließe sich daraus herleiten, es mit einem gewissermaßen technokratischen Parlament samt Regierung aus Soziologen zu versuchen? In seiner Darstellung ist immer nur von der Gesellschaft die Rede, einer Art amorpher Masse, die zwar vielfältigen Perzeptionen huldigt, aber die Wirkung von Menschen, Personen, Persönlichkeiten, die teils herausragende Leistungen erbracht haben, wird einfach negiert. Dabei bedarf es keiner großen Belege dafür, dass die ‚großen Gesten‘ überwiegend von Einzelnen, von den inzwischen gescholtenen ‚alten, weißen Männern‘ ( manchmal auch Frauen) vollbracht wurden. Das gilt selbstverständlich für fast alle naturwissenschaftlichen, technologischen Leistungen, aber auch für wegweisende politische Transformationen; man denke etwa an die Westpolitik Adenauers, die Ostpolitik Brandts, auch an die sog. Agenda-Politik Schröders, allesamt Entscheidungen, die meist im kleinsten Kreis getroffen wurden.
Damit stellt sich die Frage, ob die Grundannahme des Autors, auf ‚große Gesten‘ zu verzichten, um die notwendigen Transformationen gesellschaftlich bewirken zu können, nicht diametral anders beantwortet werden müsste. Denn es bedarf auch keiner weiteren Belege, dass das gegenwärtige Weltgeschehen tatsächlich von den ‚wirklich großen Gesten‘ befeuert wird; man denke an die USA, China, Russland, Indien und viele weitere Staaten. Dieser Blick in die große Welt zeigt, dass die Soziologie ihres verengten Blicks wegen gänzlich ungeeignet wäre, die ohnehin hypothetisch angestellte Überlegung einer Experten-Herrschaft mit Aussicht auf Erfolg bewältigen zu können.
Der Blick des Soziologen ist aber auch dann als verengt anzusehen, wenn es nur um die Deutschland betreffenden Transformationen geht; dafür liefert er unbeabsichtigt ausreichende Hinweise. Am augenfälligsten wird das an seiner altväterlichen Kritik der Kapitalismus-Kritik (70ff). Nassehi hat offenbar nicht erkannt, dass es nicht um dessen Überwindung geht, sondern darum, seine Verteilungswirkungen zu korrigieren. Die Ungleichverteilung ist national wie global, zusammen mit dem existenzbedrohenden Klimawandel und dem Artenschwund, das wohl drängendste zukünftige Problem, weil es das geordnete Zusammenleben zerstört. Mit extremer Deutlichkeit zeigt sich diese finanzkapitalistische Entwicklung an der Westküste der USA, wo eine Anzahl sogenannter Tech-Multimilliardäre zu den ‚allergrößten großen Gesten‘ ausholt, welche die Weltgeschichte erlebt hat, die durch die rasanten Fortschritte der Künstlichen Intelligenz (KI) sogar möglich werden könnten. Deutschland, Europa aber übt sich im Klein-Klein! An der Unterstützung der von Russland überfallenen Ukraine lässt sich das deutlich zeigen.
Der verengte Blickwinkel wird aber etwa auch daran deutlich, dass der Autor sich zwar seitenlang, und mit durchaus guten Gründen, mit der Identitätspolitik beschäftigt, den Lobbyismus jedoch völlig unbeachtet lässt. Dabei ist offenkundig, dass es sich um den ‚großen Bruder‘ – ein Sprachbild, das er gern verwendet – der Identitätspolitik handelt, weil die verschiedenen sozialen und ökonomischen Großgruppen dadurch ihre Interessen einbringen, die allerdings mit bedeutend größeren Ressourcen, nicht zuletzt finanzieller Art, ausgestattet sind. Das verdeutlicht zugleich, dass er die Wirtschaft als sozialen Akteur nicht zum relevanten Teil der Gesellschaft zählt, und ihr deshalb kaum Beachtung zuwendet.
Sein Versuch, die Potentiale für notwendige Veränderungen in konkreten Gegenwarten zu finden (212 ff.), mutet ein wenig feuilletonistisch an, weil er zwar durchaus begrüßenswerte Beispiele nennt, sich aber nicht selbst befragt, weshalb gerade sie von der doch so disparaten Gesellschaft akzeptiert werden sollten: einfach nur weil sie ‚klein‘ sind? Davon abgesehen ist anzunehmen, dass diese wirklich gut gemeinten Ansätze, die überwiegend von Start-ups hervorgebracht werden, nicht nur langsam wirken, sondern, sobald sie skalierbar sind, ganz schnell von finanzstarken Investoren aufgekauft werden, wie es in der Vergangenheit beinahe regelmäßig geschah – um dann doch wieder als ‚große Geste‘ zu enden.
Die vom Autor präferierten ‚kleinen Gesten‘ bedeuten zugleich auch eine nicht bedachte Absage an die internationale Zusammenarbeit, etwa in der EU, der NATO, letztlich sogar im System der Vereinten Nationen, auf die zu verzichten aus vielfältigen Gründen kaum vorstellbar, sicher aber nicht wünschbar ist, angesichts der weltpolitischen Neuordnung. Die rückwärtsgewandte, vielleicht nur gedankenlose Haltung, die von einer randständigen Partei vertreten wird, ist nicht in der Gegenwart angekommen, hat die ‚Zeitenwende‘, die Welt im grundlegenden Wandel noch nicht integriert. Selbst angesichts der verteidigungspolitischen Herausforderungen hätte das zur Folge, den Kopf in den Sand zu stecken.
Versucht man den beredeten Text zusammenzufassen, gelangt man zu dem ernüchternden Ergebnis, dass der Autor zwar ‚anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken‘ will, aber allenfalls in eingestreuten Nebensätzen schreibt, wer für wen was transformieren soll; wichtig ist ihm nur, dass es nicht mit ‚großer Geste‘ erfolgt. Wenn man die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre verfolgt, lässt sich statistisch deutlich belegen, dass sein Votum schon gute Erfolge erzielt hat. Deutet man die Politik der amtierenden Bundesregierung richtig, so ist auch sie in diesem ‚Herbst der Reformen‘ auf einem guten Weg. Nur die riesige Schuldenaufnahme sollte man ausblenden, auch wenn sie auf weitgehende Zustimmung in Wirtschaft und Gesellschaft trifft, die nicht so unfähig zur Einsicht scheint, wie der Autor annimmt.
Daher eine kurze Zwischenbemerkung. Man kann all die vielleicht wirklich bestehenden negativen Konnotationen extrapolieren; man kann sich aber auch bemühen, die gegebenen Einstellungen in eine nicht-lineare, positivere, gemeinschaftsverträglichere und demokratiegerechte Richtung umzulenken, um dadurch zugleich die Meinungsführerschaft der nur so genannten sozialen Medien zu beschränken. Das ist übrigens ein gelungener Euphemismus der Empörungs-Unternehmer, die durch die Manipulation ihrer Algorithmen in der Lage sind, in vermehrtem Umfang ‚neue Unübersichtlichkeiten‘ zu schaffen. Das ist als Anregung gedacht, nicht als Auftrag an eine Soziologie in pädagogischer Absicht.
Der Soziologe, der als ruheloser Wissenschaftler bloß ‚große Worte‘ in die Arena der Auseinandersetzungen werfen will, kann sich zufrieden zurücklehnen. Man muss sich also keine Sorgen machen, weder um die dringend not-wendigen Transformationen noch um die Soziologie – oder vielleicht doch? Jedenfalls handelt es sich bei Nassehis Text um eine auf- und anregende Buchstabenfolge.
Zum Schluss ein Aperçu: Ich singe Dir `ne Welt / wie sie Mir gefällt.