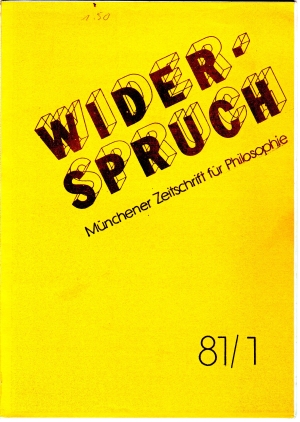Alexander von Pechmann
Ideologiekritik im „Widerspruch“
Phasen der Kritik und Selbstkritik
I.
1980 gegründet, war der „Widerspruch – Münchner Zeitschrift für Philosophie“ seinem Selbstverständnis nach ein Kind der Studentenbewegung. Anders als etwa das Berliner „Argument“, das sich in den 60er Jahren seinen Standpunkt erst erarbeitet hatte, war der Widerspruch von Beginn an fertig. Er hatte einen klaren Standpunkt und hatte sich, wie das Editorial der ersten Nummer darlegt, einen ausgewiesenen ideologiekritischen Auftrag gegeben. Damals, Anfang der 80er Jahre, herrschten in der Münchner Philosophie zwei Richtungen: auf der einen Seite die traditionelle geisteswissenschaftliche Ausrichtung, die von den Philosophen Hermann Krings, Robert Spaemann und Dieter Henrich repräsentiert wurde, und auf der anderen die in den 60er Jahren entstandene Wissenschaftstheorie, die von Wolfgang Stegmüller etabliert und vertreten wurde.
Mit der Zeitschrift Widerspruch sollte auch in München die mit der Studentenbewegung wiedererweckte historisch-materialistische Philosophie eine Plattform erhalten, die zugleich die ideologiekritische Auseinandersetzung mit den dominierenden konservativen und liberalen Positionen suchen wollte. So hatten denn auch die Hefte der ersten Jahre eine klare Linie: „Wissenschaft und sozialer Fortschritt“, „Freiheit der Wissenschaften?“, „Friedensbewegung und Friedenstheorie“, „Hilfe zur Selbsthilfe im Konservatismus“ waren die Titel der Hefte. Sie führten in ihren Beiträgen vom historisch-materialistischen Standpunkt aus die Auseinandersetzung um die Demokratisierung der Gesellschaft und die Erhaltung des bedrohten Friedens auf den Konfliktfeldern der damaligen Zeit: den Berufsverboten für fortschrittliche Wissenschaftler wie Horst Holzer, der Nato-Nachrüstung durch die Pershing II-Raketen oder der von der neuen Kohl-Regierung ausgerufenen „geistig-moralischen Wende“. Und das Heft über die „Philosophie im Faschismus“ unternahm es erstmals, das von der herrschenden Philosophie bislang Verdrängte aufzuarbeiten.
So klar und einheitlich der philosophische Standpunkt zu dieser Zeit auch war, so zeigten sich doch Unterschiede und Unsicherheiten auf dem Feld der Ideologiekritik: Sollte man die Auseinandersetzung mit den konträren Auffassungen polemisch führen, ihnen Widersprüche der Argumentation nachweisen, um ihre Vertreter lächerlich zu machen, oder hinter der scheinbar wohlklingenden Rede die unlautere Absicht, das versteckte Herrschaftsinteresse, entlarven, sollte die Kritik also die Leser:innen über die geistige Beschränktheit bzw. die Verlogenheit der Autoren aufklären? Oder sollte Ideologiekritik vielmehr erklärend verfahren, indem sie zeigt, wie und welche gesellschaftlichen Interessen sich in den jeweiligen Theoriegebäuden artikulieren, um so den geistigen Überbau auf seine materielle Basis zurückzuführen? – Und weiterhin: Sollte diese Kritik eher theoretisch oder praktisch motiviert sein, und wäre demnach das Kriterium der Kritik die logische Kohärenz der Argumentation oder aber die Gemeinsamkeit der politischen Ziele? So wurde denn auch auf manche politische „Bündnispartner“, wie den christlichen Sozialisten Helmut Gollwitzer, munter eingeprügelt, um seinen wirklichkeitsfremden Idealismus zu entlarven, während andere aus politisch motivierter Absicht von der Kritik verschont blieben.
II.
Schon bald jedoch fing die klare ideologiekritische Frontstellung zwischen wahrem und verkehrtem Bewusstsein an sich aufzulösen. Neue Fragen und Problemfelder wurden relevant: Mit den Heften „Computer – Denken – Sinnlichkeit“ und zur „Gen-Technologie“ setzte Mitte der 80er Jahre die sozialphilosophische und ethische Auseinandersetzung der Zeitschrift mit den neuen Technologien der digitalen bzw. genetischen Informationsverarbeitung und ihren damals noch unüberschaubaren Anwendungsbereichen ein. Die zunehmend ins Bewusstsein tretende Umweltzerstörung in West und Ost, die Herausforderungen der Frauenbewegung für das traditionelle Rollenverständnis, die neue Suche nach sozialer und geistiger Geborgenheit mit ihrer wachsenden Sensibilität für die Heimat – diese Themen der 80er Jahre passten nicht mehr recht in das bisherige ideologiekritische Schema von „wahr“ und „verkehrt“. Überblickt man die Beiträge der Hefte dieser Zeit, zur „Wiederkehr des Mythos“, zur „Heimat. Zwischen Ideologie und Utopie“ oder zum „Frauen-Denken“, so erkennt man, dass nun ein anderes Schema vorherrschend wurde, das Schema einer dialektischen Differenzierung: Einerseits, so die Argumentation, enthalten die genannten Technologien wie die neuen sozialen Bewegungen etwas Wahres, da sie das menschliche Handlungspotential erweitern bzw. das Unbehagen an Strukturen des bestehenden Gesellschaftssystems artikulieren; andererseits bergen dieselben Phänomene jedoch auch Gefahren, weil die neuen Techniken als Mittel der Herrschaftskontrolle oder Profitmaximierung missbraucht werden, bzw. die Umwelt- und Frauenbewegungen zugleich ein romantisch-reaktionäres Gedankengut, einen „gefährlichen Irrationalismus“, wie es hieß, transportierten. Hier angesichts der Komplexität und Interpretationsvielfalt der neuen technischen wie sozialen Phänomene das Angemessene zu treffen, erwies sich als schwierig; der vormals eindeutige ideologiekritische Standpunkt löste sich in den verschiedenen Beiträgen der Hefte in ein schillerndes Spektrum unterschiedlicher Auffassungen auf.
III.
Die katastrophé der Ideologiekritik, die zum Umdenken zwang, kam für den Widerspruch 1987, drei Jahre vor der Umwälzung der globalen Verhältnisse. Das Heft zum „Neuen Denken“ war noch nach dem bisherigen Muster als kritische Auseinandersetzung mit der damals einflussreichen New-Age-Bewegung geplant. Dieser Art des Aufgreifens gesellschaftlicher Phänomene kam jedoch das sowjetische Konzept des „Neuen Denkens“ dazwischen: Es stellte das bisherige Fundament einer historisch-materialistischen Analyse und Kritik recht grundsätzlich in Frage. Denn jetzt sollte nicht mehr der historische Fortschritt, d.h. eine antikapitalistische, auf Befreiung zielende Praxis, der Kompass sein, der die Ideologiekritik motiviert und orientiert, sondern das gerade Gegenteil: die angesichts der globalen Probleme, des atomaren Wettrüstens, der Naturzerstörung und der Unterentwicklung der Dritten Welt, gefährdete Existenz und damit die Erhaltung der Menschheit.
Von diesem Standpunkt der Bewahrung der Menschheit aus musste nun aber die Auffassung vom Fortschritt als Ideologie erscheinen, die zuvor doch Grundlage und Zweck der ideologiekritischen Arbeit war. „Auch die Ideologiekritik kann ideologisch und falsch sein“, heißt es jetzt im Heft. „Die Ideologiekritik muss also selbst noch einmal einer Ideologiekritik unterzogen werden.“ Sollte angesichts der atomaren und ökologischen Bedrohungen diese Konzeption die richtige und damit das Bewusstsein von der Bewahrung der Menschheit das wahre sein, dann, so die naheliegende Schlussfolgerung, wäre die bisherige Ideologiekritik auf der Grundlage eines ‚beschränkten Bewusstseins‘ erfolgt, sie wäre, als ‚naiver Fortschrittsoptimismus‘, selbst Ideologie gewesen.
Die Konfrontation der zwei Paradigmen „Fortschritt“ versus „Bewahrung“ gefährdete das Projekt Widerspruch. Sie zwang, was bislang nicht nötig war, zur Reflexion und zur Verständigung über die eigenen Grundlagen. Diese Phase der Selbstreflexion fand ihren Niederschlag in zwei Heften mit den – zuvor als absurd erschienenen – Titeln am Anfang der 90er Jahre: „Ende der Linken?“ und „Wozu noch Intellektuelle?“. Sie stellten eben das zur Disposition, was seit Gründung der Zeitschrift ihr unproblematisches philosophisches Fundament gewesen war. „Die Linke“, so wurde jetzt festgestellt, „bedarf einer geschichtlichen Perspektive; aber die realen Bedingungen dafür fehlen heute offenbar. Ist mit dem Ende des ‚realen Sozialismus‘ auch die Linke am Ende?“ Bedeutet das, dass mit der epochalen Wende der Typus des Linksintellektuellen, der sich der emanzipatorischen Ideologiekritik verpflichtet wusste, vom „Sieger der Geschichte“ nun zum allseits verhöhnten „Auslaufmodell“ geworden ist?
IV.
Versucht man angesichts der Vielfalt der Stimmen, die sich zu dieser Selbstverständigungsdebatte im Widerspruch zu Wort gemeldet haben, ein neues Fundament für die Zeitschrift herauszuschälen, so bestand dies zum einen in der bitteren Einsicht in die Alternativlosigkeit des Bestehenden und, damit verbunden, in die Ortlosigkeit systemverändernder Praxis sowie zum anderen in der Suche nach der Neuverortung linker Theoriebildung innerhalb des bestehenden Systems. „Am Ende“, so hieß es jetzt, sei „eine Theorie und Praxis …, die Geschichte als einen ‚dialektisch-gesetzmäßigen Fortschritt zum Sozialismus‘ zu verwirklichen glaubte. Der Sozialismus als ‚Ideal‘ hingegen erschien den meisten Autoren als weitgehend ungebrochen“, – ohne freilich dieses „Ideal“ wie auch den Ort linker Theoriebildung genauer bestimmen zu können.
Auf der Basis eines solchen Verzichts auf die geschichtsphilosophische Dimension des eigenen Selbstverständnisses kristallisierte sich in der Folgezeit ein neues Muster der Ideologiekritik heraus. An die Stelle der vormaligen Schemata der Polarisierung bzw. dialektischen Differenzierung trat nun die Aufgabe, die „immanenten Widersprüche“ des Systems herauszuarbeiten und sie gegenüber denjenigen Ideologien kenntlich zu machen, die den sich nun globalisierenden Kapitalismus – der freilich so nicht mehr genannt werden durfte – verklärten. So hatten in den 90er Jahren die Hefte vor allem die Konfliktlinien, Gegensätze und Widersprüche des sich herausbildenden Weltsystems zum Gegenstand: Die Beiträge zur „multi-kulturellen Gesellschaft“ thematisierten die Konfliktpotentiale zwischen der Eigen- und Fremdkultur, die aus der Auflösung der bisherigen Grenzen erwuchsen, wiesen freilich auch auf die darin enthaltene Utopie eines friedlichen Miteinanders der Völker und Kulturen hin. „Markt und Gerechtigkeit“ widmete sich der wachsenden Verteilungsschere der materiellen und sozialen Güter und kritisierte den zunehmenden Realitätsverlust der systemkonformen Markt-Ideologien. Die Hefte über „Gewalt und Zivilisation“ und „Nie wieder Krieg“ versammelten Beiträge, die das scheinbar paradoxe Phänomen untersuchten, dass trotz der Zivilität der Gesellschaft die Gewalt im Inneren wie nach Außen zunimmt, und wie der Einsatz militärischer Gewalt heutigentags ideologisch legitimiert wird. Und das Heft zu einer „Philosophie des Mülls“ schließlich machte den ökologischen Skandal zum Thema, dass „zwischen die Reiche der Freiheit und der Natur die Berge aus Müll wachsen.“
Nach dem Verlust der Zukunftsperspektive brachte das neue Schema der „inneren Widersprüche“ zwar den heilsamen Zwang, genauer auf die Tatsachen hinschauen zu müssen, um sie aufdecken zu können. Es hatte aber den Mangel, diese Widersprüche nicht mehr als Triebfedern seiner revolutionären Umgestaltung begreifen, sondern das kapitalistische System nur immanent an seinen eigenen Ansprüchen der Freiheit, Gleichheit oder Gerechtigkeit messen zu können. Durch eine solche immanente Kritik sollte zumindest das „Ideal“ des Sozialismus und damit das Bewusstsein des Anders-Möglichen in Erinnerung gehalten werden.
V.
Um die Jahrhundertwende dann wurden die öffentliche Kritik und die Proteste gegen die Globalisierung lauter. Im Heft „Wagnis Utopie“, erschienen 1999, heißt es erstmals wieder: „Die Zeit scheint reif zu sein, über das was ist, hinaus wieder das, was sein soll und sein kann, zu denken, Utopisches als ein real-mögliches Gegenbild zum Bestehenden zu entwerfen.“ Diesem Gegenbild stand jedoch entgegen, dass die sich neu formierenden Antiglobalisierungsbewegungen als Träger des Protestes sich in der Realität als äußerst heterogen zeigten. Sie zu verstehen und zu begreifen, zwang die Zeitschrift, den Horizont der bisherigen Ideologiekritik zu erweitern; sie stellten damit aber auch das Fundament der immanenten Kritik erneut und auf andere Weise in Frage. Hatte das Heft über „Afrikanische Philosophie“ noch die Debatte der afrikanischen Philosophen um die verheerenden Auswirkungen des Weltmarkts auf die traditionellen Lebens- und Wirtschaftsformen zum Thema, traten jetzt außereuropäische Akteure aus dem lateinamerikanischen, islamischen, indischen und chinesischen Raum auf den Plan. Ihr Auftreten musste den bisherigen sozialphilosophischen Rahmen der Kritik um die Dimension des Kulturellen erweitern.
Die Auseinandersetzung mit diesen neuen Trägern des Protestes provozierte jedoch zugleich die Frage, ob und inwiefern der eigene Standort und die bisherige Form der Ideologiekritik tiefer in der europäischen Denktradition verwurzelt waren als gedacht. Die Artikel in den Heften am Anfang dieses Jahrzehnts über die „Kritik der Globalisierung aus außereuropäischer Perspektive“ und über den „Kampf der Kulturbegriffe“ trugen diese Debatte um die Universalität resp. Relativität des eigenen Standpunkts aus. Insbesondere die Autoren nicht-westlicher Kulturen wehrten sich gegen die Zumutung, „die Wahrheit durch die eigene Tradition exklusiv zu definieren.“ Ihnen standen – recht vermittlungslos – Beiträge gegenüber, die sich dagegen verwahrten, den Universalitäts- und Wahrheitsanspruch der eigenen Position preiszugeben. So deutete ein Teil der Beiträge die außereuropäischen Proteste als verständliche Reaktionen auf die Zumutungen einer „Verwestlichung“, andere sahen in ihnen vormoderne Antworten auf die stattfindende Modernisierung. Ein ähnliches Bild zeigten die Hefte über den „Wertestreit um Europa“ und die „Perspektiven postnationaler Demokratie“. Während die einen Autoren die politische Integration Europas an den eigenen, den europäischen Werten maßen, erkannten andere Autoren in dieser Entwicklung die Neuformierung eines imperialen Lagers, die „Anpassung des institutionellen Überbaus an die ökonomischen Notwendigkeiten.“
VI.
Am Ende des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts schien es, dass mit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 nun wieder die alten und vertrauten Krisenphänomene der kapitalistischen Produktionsweise und damit auch Vorstellungen sozialistischer Alternativen zurückkehrten. Die Rückkehr dieser Krisen konnte zwar dazu dienen, die vormaligen Beiträge zur Kritik der Marktideologien nachträglich zu rechtfertigen; sie machte aber zugleich die Diskussion um reale Alternativen zum System der Marktwirtschaft unabweislich, das nun öffentlich auch wieder als „Kapitalismus“ bezeichnet werden durfte. Diese Suche nach Alternativen zum Bestehenden stand denn auch im vergangenen Jahrzehnt im Zentrum. So unternahm es das Heft „1968 – Ideen, Entwürfe, Utopien“ Antworten auf die Fragen nach dem Erinnerungswerten und Unabgegoltenen der 68er Bewegung zu geben; und das Heft über „Alternative Ökonomien“ erörterte die Konzepte einer „Wohlfahrts-“, einer „Solidarischen“ bzw. einer „sozialistischen Ökonomie“, die den Anspruch erhoben, den neuen globalen sozialen wie ökologischen Herausforderungen Rechnung zu tragen.
Auf der politischen Ebene setzten die Hefte über das „Vertrauen in der Krise“ (51), „Brauchen wir Eliten?“ (53), „DemoKratie“ (57) sowie über die „Arcana Imperii. Die dunkle Seite des Staates“ (59) sich nicht nur mit der gegenwärtigen Krise der Repräsentation und dem schwindenden Vertrauen in das Modell der parlamentarischen Demokratie auseinander, sondern suchten auch nach den institutionellen Bedingungen, unter denen die Überwindung dieser Kluft zwischen der sozialen Lebenswelt und dem politischen System möglich wäre. Im historischen Rückblick auf die Zeit nach dem 1. Weltkrieg dann sollte das spätere Heft zur „Räterepublik in Bayern“ (67) den Streit um das Rätesystem als eine Alternative zum Modell der parlamentarischen Demokratie vergegenwärtigen.
Mit den weltweiten Protestbewegungen gegen das westliche kapitalistische System, allen voran dem „arabischen Frühling“, tauchte dann auch wieder die alte, in der Versenkung verschwundene Frage nach dem „revolutionären Subjekt“ als dem sozialen Träger der politischen Veränderung auf, mit dem das Heft Nr. 55 sich befasste. Dessen Beiträge blieben freilich, im Rückblick gesehen, recht vage und diffus. Sie waren offenbar mehr Ausdruck eines Wunsches als der Wirklichkeit. Ähnliches galt auch für das Heft über die: „Philosophie in China“. Die Beiträge in diesem Heft gaben zwar einen ausgezeichneten Ein- und Überblick über das traditionell säkular und pragmatisch geprägte Denken in der Volksrepublik China und arbeiteten auch die Differenzen zu einem westlichen ‚Universalismus‘ heraus; sie ließen aber die Frage nach einem möglichen Gegengewicht zum westlichen Modell des Kapitalismus unbeantwortet.
Auf der Ebene des Sozialen war dann das Heft zum „Internet und der digitalen Gesellschaft“, 2010 erschienen, mit der Vorstellung und Hoffnung auf einen, technologisch bedingten, Wandel verbunden. Das World Wide Web beginne, so hieß es einführend, „die reale Welt des Kapitalismus zu unterminieren“. Es habe „der Vision einer Weltrepublik mit freier Kommunikation neue Nahrung gegeben, einer demokratischen Öffentlichkeit, bei der alle nationalen und sozialen Schranken fallen werden.“ Bei allen Verweisen auf die Gefahren des Missbrauchs überwog in den Beiträgen doch die Hoffnung auf die Chancen eines künftigen „herrschaftsfreien Diskurses“. Werch ein Illtum! – Wie sehr sich diese Perspektive auf die „digitale Gesellschaft“ seither gewandelt hat, verdeutlichen dann die Hefte des Widerspruch über den „Trans-Humanismus“ (66), der den Menschen „das Maß einer (womöglich sich selbst optimierenden) Maschine“ anlegen möchte, über die neuen Möglichkeiten der Verbreitung bornierter Weltbilder und der Verfestigung von Vorurteilen in den Sozialen Medien, denen die Nr. 69 „Öffentliche Meinung und Wahrheit“ gewidmet war, sowie das letzte Heft des Widerspruch über die „Künstliche Intelligenz“ (75). In dessen Zentrum stand nun der „digitale Kapitalismus“, der auf seiner Jagd nach Profit eine rücksichts- und gnadenlose Konkurrenz der High-Tech-Giganten auf dem Weltmarkt bewirkt hat, der die Gesellschaften und staatlichen Institutionen derzeit weitgehend hilflos gegenüberstehen.
VII.
Die Suche nach Alternativen wurde schließlich ab der Mitte des vergangenen Jahrzehnts durch das neue Phänomen überlagert, dass die Kritik am bestehenden System sich politisch nicht mehr nur links verorten ließ, sondern dass sie sich auch in rechten Ideologien artikulierte. So sah sich die Tagung des Widerspruch „Was ist links heute?“ im Jahr 2015, die das Heft Nr. 61 dokumentierte, mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Kapitalismuskritik nicht mehr als das ‚Privileg der Linken‘ angesehen werden kann, und dass im öffentlichen Diskurs die Grenzen zwischen links und rechts oft ineinander verschwimmen. Aufgabe der Tagung sollte es daher sein, unter dem Begriff „links“ nicht nur die komplexe Vielfalt linker Aktivitäten zusammenzufassen, sondern sie auch klar gegenüber der rechten Ideologie abzugrenzen. So sehr Einigkeit darüber bestand, dass die Prinzipien linken Handelns der Abbau jeglicher Herrschaft von Menschen über die Menschen und die Natur sowie der weltweite und supranationale Kampf um soziale Gerechtigkeit sind, so kontrovers blieb unter den Teilnehmern freilich die Frage nach den realistischen Wegen zu diesen Zielen.
Das Heft Nr. 68 hatte dann „Die Neue Rechte“ selbst zum Thema. Dabei bestand das Interesse nicht nur darin, dass und wie im öffentlichen Diskurs wieder zunehmend traditionell rechtes Gedankengut einfließt, sondern auch daran, dass die „Neue Rechte“ es nicht ohne Erfolg übernommen hat, traditionell antikapitalistische Theorien und Strategien der Linken in das Projekt einer „nationalen“ bzw. „völkischen Identität“ zu integrieren. Dieser Vermischung von links und rechts gingen denn auch die Beiträge des Hefts über die „Identitätspolitik“ (72) nach, die den Rechten dazu dient, die ‚völkische Substanz‘ zu erhalten, während sie im linken Diskurs vorhandene Diskriminierungen kenntlich machen soll, um sie überwinden zu können.
VIII.
Der Verlust des linken Monopols auf die Kritik des bestehenden Systems führte im Weiteren dann zu einer notwendig gewordenen Reflexion auf die eigenen philosophischen Grundlagen. So bedürfe es angesichts der politisch-ökonomischen Entwicklungen sowie der ökologischen Herausforderungen einer Neubestimmung des altehrwürdigen Begriffs des „Fortschritts“ als Leitidee linker Praxis, der das Heft Nr. 54 gewidmet war. Fortschritt, so der Tenor der Beiträge, lasse sich nicht mehr quantitativ und naiv als ein Mehr an materiellen wie immateriellen Gütern bestimmen. Der Begriff müsse heute zugleich und konstitutiv die natürlichen und einschränkenden Bedingungen und Ressourcen einer solchen Praxis einbeziehen. In ähnlicher Weise thematisierte das Heft Nr. 71, „Problemfall Arbeit“, einen zentralen Begriff jeder historisch-materialistischen Theorie. War es nach diesem Verständnis weder die Vorsehung noch das Schicksal, sondern die Arbeit, durch die die menschlichen Zivilisationen sich überhaupt entwickelt haben, habe sie heute jedoch, wie es im Vorwort hieß, „viel von ihrer ehemaligen Wertschätzung eingebüßt“. Zum einen werde die Arbeit nicht mehr als gestaltend und befreiend, sondern zunehmend als belastend und einschränkend erfahren; und zum anderen sei jede Arbeit als zweckmäßige Tätigkeit zugleich auch ein destruktiver Eingriff in die je vorhandene Natur. Dies aber fordere heraus, neu über die künftige Rolle und Funktion der Arbeit in und für die Gesellschaft nachzudenken.
Entsprechend setzte sich denn auch das Heft Nr. 74 kritisch mit der traditionellen Idee von der einen fortschreitenden Menschheitsgeschichte auseinander. Die Beiträge des Hefts kamen alle zu dem ideologiekritischen Ergebnis, dass die Idee der Kontinuität der Geschichte heute legitimerweise durch die Vorstellung einer Vielzahl kulturell unterschiedlicher Geschichtsverläufe sowie unterschiedlicher Perspektiven des Erzählens von Männer und von Frauen, von Kolonisatoren und von Indigenen zu ersetzen sei.
Diesem Rückbezug auf die eigenen philosophischen Grundlagen dienten auch die Hefte Nr. 65 und 70 zu Karl Marx und Friedrich Engels aus Anlass ihres 200. Geburtstags. In deren Zentrum standen die Fragen und Probleme der dialektischen Methode und ihrer Konzeption von Gesellschaft wie von Natur. Hinsichtlich der Frage nach der Alternative zur kapitalistischen Produktions- und Konsumtionsweise bestand in den Beiträgen jedoch Übereinstimmung, dass mit der von Marx und Engels prognostizierten „Diktatur des Proletariats“ unter den gegebenen Verhältnissen nichts mehr anzufangen sei.
Im Zeichen dieser Rückbesinnung standen zwei weitere Hefte aus jüngster Vergangenheit, die sich grundsätzlich mit der Funktion und der Rolle des Eigentums befasst haben, das von Marx und Engels als wesentlich für die Struktur der Gesellschaft erachtet worden war. Das Heft zur „Eigentumsfrage“ (64) konstatierte, dass die Frage nach Alternativen zum Privateigentum heute ein öffentliches Tabu ist. Während sich sichtbar die Belege häuften, dass die Institution des Privateigentums nicht, wie angenommen, die Wohlfahrt aller fördert, sondern Wenigen den Reichtum und Vielen die Armut beschert, und zudem den Planeten zerstört, findet keine öffentliche Debatte um alternative Eigentumsformen statt. Die anschließende Tagung des Widerspruchs „Privateigentum auf dem Prüfstand“ im September 2022, die in Heft 73 abgedruckt wurde, hatte mit ihren Beiträgen das Ziel, über die Kritik am Privateigentum hinaus die Debatte um alternative Formen eines gemeinschaftlichen Eigentums wiederzubeleben.
Zusammenfassung
Will man abschließend angesichts des Zeitraums von bald 50 Jahren ein Fazit ziehen, so hat das Projekt „Widerspruch“ seinem Namen durchaus Ehre gemacht. Es stand während dieser Zeit in der Tat im Widerspruch zu den herrschenden Ideologien. Allerdings wandelte sich durchaus das, was unter einem solchen Widerspruch zu verstehen ist, und zu was er dient. Wurde er zuerst gewissermaßen als die Lokomotive des Fortschritts und seiner „Aufhebung auf höherer Stufe“ gedacht, musste er dann eher als ein Forum verstanden werden, das es unternimmt, die vorhandenen Gegensätze zuzuspitzen, sie aber dennoch auszutragen und auszuhalten, um den Widerspruch schließlich eher im Sinne eines Einspruchs gegen die (scheinbar?) verfestigten und alternativlosen Verhältnisse zu deuten.
Dass der Widerspruch, gewollt oder ungewollt, ein Kind seiner Zeit war, hat seinen Ausdruck letztlich auch in der Resonanz der Themen beim Publikum und damit in den Verkaufszahlen der Hefte gefunden. Als eine solche „Lokomotive des Fortschritts“ wurde der Widerspruch anfangs breit, auch in der Tagespresse, rezipiert. Auch in seiner zweiten Phase als „Forum der Kontroversen“, im „Denken des Anderen“, hatte er noch sein breiteres Publikum. Mit der Verfestigung der bestehenden Verhältnisse jedoch wurde er mit zunehmender Selbstflexion linker Theoriebildung zu einem „Rufer in der Wüste“, dessen Einsprüche doch weitgehend verhallten und nur mehr eine vergleichsweise kleine Leserschaft hatte. Selbstkritisch werden wir uns eingestehen müssen, dass wir, trotz aller Bemühungen, die allmähliche Marginalisierung der linken Theoriebildung nicht haben aufhalten können. Sic tempora mutantur.