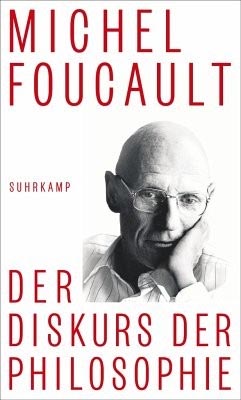Michel Foucault
Der Diskurs der Philosophie
geb., 352 Seiten, 34,00 €, Suhrkamp-Verlag, Berlin 2024
von Paul Stephan
Dass man noch einmal ein neues Werk von Foucault in den Händen halten würde, hätten wahrscheinlich die wenigsten Interessenten noch für möglich gehalten. Doch in Foucaults Nachlass fanden dessen Herausgeber tatsächlich ein mehr als 400 Seiten umfassendes handschriftliches Manuskript aus dem Jahr 1966, Le discours philosophique.
Freilich ist die Bezeichnung „Werk“ womöglich nicht ganz angemessen. Das Manuskript scheint zwar in einem ausgearbeiteten Zustand zu sein und warf, so die Herausgeber, „keine besonderen editorischen Schwierigkeiten“ (9) auf, doch es wirkt trotz seiner klaren Struktur und Gedankenführung letztlich nicht ganz zu Ende reflektiert, scheint am Ende abzubrechen und keinem richtigen Fazit zuzulaufen.
Für jeden Kenner der sonstigen Schriften Foucaults wirkt es freilich überraschend. Auch wenn das Buch zahlreiche Gedanken und Motive enthält, die später Einzug in Foucaults publiziertes Werk erhielten – wie die Herausgeber in ihrem äußerst hilfreichen Kommentarapparat und Nachwort detailliert darlegen –, unterscheidet es sich in Inhalt und Form doch deutlich von ihnen. Dies macht es zu einer durchaus lohnenden Lektüre nicht nur für Foucault-Kenner: Hier wird eine Abzweigung in Foucaults Denkweg deutlich, die dieser bewusst nicht beschritt und ihn deswegen in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Denn Foucault beschreibt in diesem Text nicht nur den philosophischen Diskurs von außen. Er situiert sich viel eindeutiger als in seinem publizierten Werk, in dem er der Frage, ob er denn nun ein Philosoph sei oder nicht, stets auswich, innerhalb dieses Diskurses und fragt nach den Bedingungen und Möglichkeiten seiner Fortsetzung in einer seit Nietzsche radikal gewandelten Denklandschaft. Und er konfrontiert sich selbst sehr klar mit Einwänden und Fragen, die gegen ihn von philosophischer Seite oft vorgebracht wurden, insbesondere derjenigen nach den – historischen wie logischen – Bedingungen und Möglichkeiten seines eigenen kritischen Projekts und bemüht sich um die Klärung einiger zentraler Grundbegriffe desselben (zum Beispiel Diskurs, Archäologie, Diagnose, Archiv …). Mit anderen Worten: Hätte Foucault dieses Manuskript fertiggestellt und publiziert, wäre sein Denken viel deutlicher der Philosophie zuzuordnen, als es auf der Grundlage seiner veröffentlichten Texte der Fall ist. Doch offenbar entschied sich Foucault bewusst gegen diese Möglichkeit.
Um was geht es nun genau? Vorneweg gilt es zu betonen, dass das Buch gerade im Vergleich zu Foucaults sonstiger Prosa extrem trocken und technisch geschrieben ist. Man hat wirklich das Gefühl, ein philosophisches Fachbuch zu lesen, in dem Foucault versucht, auf Augenhöhe in den philosophischen Diskurs seiner Zeit zu intervenieren. Nicht immer ist es ganz einfach, Foucaults äußerst technischen Ausführungen zu folgen.
Zunächst bestimmt Foucault die Philosophie als eine besondere Form des Sprechens, dem in der „abendländischen“ Kultur eine relativ konstante Grundaufgabe zukomme, „zu diagnostizieren“ (13): „Der Philosoph muss ganz einfach sagen, was ist“ (17), er muss die verborgene Wahrheit seiner Gegenwart aufdecken. Doch was heißt das genau, und welche verschiedenen Modi nahm diese eigentümliche Tätigkeit in den letzten 2.500 Jahren an? Und wie es ist um die Philosophie heute bestellt, wie kann sie nach Nietzsche diese Aufgabe noch wahrnehmen? Dies sind die Fragen, die sich Foucault eingangs stellt – und sie bereits machen deutlich, dass es sich um eine philosophische Abhandlung handeln muss, insofern Foucault eine genau solche Diagnose zu betreiben versucht, nur eben als „Diagnose der Diagnose“, als Aufzeigen der verborgenen Wahrheit der Philosophie selbst.
Foucault bemüht sich nun in mehreren analytischen Schritten, die genaue Beziehung zu umreißen, in die der Philosoph zur Gegenwart tritt, und sie von anderen Weisen des Sprechens – Alltagsdiskurs, Wissenschaft und Literatur – abzugrenzen. Inhalt und Form lassen hier wiederum stark den Eindruck einer philosophischen Abhandlung entstehen: Waren es nicht klassische Philosophen wie Hegel oder Kant, die sich ganz ähnliche Frage stellten und sie mithilfe einer ähnlich minutiösen Arbeit am Begriff zu beantworten suchten? Jedenfalls steht Foucault, wie bereits hier deutlich wird, in dieser Abhandlung dem Strukturalismus sehr nahe: Es geht ihm um die genaue Abgrenzung und Beschreibung bestimmter diskursiver Strukturen innerhalb des Gesamtdiskurses des „Abendlandes“.
Allerdings geht Foucault davon aus, dass sich seit dem 17. Jahrhundert, also seit Descartes, ein ganz neuer Modus des philosophischen Diskurses etabliert hat, der völlig anders als derjenige der vorherigen Jahrtausende sei, und dessen Status mit dem „Ereignis“ Nietzsche prekär werde. Im Rahmen der sich in dieser Zeit vollkommen neu etablierenden Arbeitsteilung der unterschiedlichen Diskursmodi komme der Philosophie die seltsame und paradoxe Aufgabe zu, universelle Wahrheit und partikulare Position eines Subjekts zu synthetisieren. Dies unterscheide sie vom Alltagsdiskurs, der einfach nur partikular sei und keinen höheren Anspruch auf Wahrheit erhebe, aber auch den universellen Diskursen der Wissenschaft und der Literatur, in denen das Subjekt des Sprechenden und dessen partikulare Position unerheblich sei. Das Spezifische am philosophischen Diskurs seit Descartes’ „cogito ergo sum“ sei also sein subjektiver Charakter, dass er stets aufzeige und rechtfertige, wie das Subjekt die Wahrheit erkennen könne. Wobei klar sei, dass dieses „Subjekt“ nicht einfach die partikulare Person des Philosophen ist, sondern sich auch als transzendentales Subjekt äußern kann – was aber zwangsläufig das Problem aufwerfe, wie beide Seiten des Subjekts sich zueinander verhalten.
Vor dem 17. Jahrhundert hätte es diese klare Arbeitsteilung der unterschiedlichen Diskursmodi noch gar nicht gegeben, und dies unterscheide die Philosophie davor und danach radikal voneinander. Ihre Gegenstände mögen zwar auf den ersten Blick dieselben sein, doch der Modus, in dem über diese Gegenstände gesprochen wird, sei ein vollkommen anderer.
Eine Erklärung, warum es zu diesem Bruch gekommen sei, führt Foucault dezidiert nicht an; vielmehr weist er Theorien, die sich um die kausale Erklärung kultureller Umbrüche bemühen – wie insbesondere und wiederholt den Marxismus –, dezidiert zurück. Derartige Wandlungen seien das Ergebnis kontingenter heterogener Verschiebungen. Und ebenso weist er es zurück, von irgendwelchen Beeinflussungen zwischen den genannten Diskursen auszugehen. Sie existierten vielmehr ab dem mystischen Ereignis ihrer Begründung, für das es keine Erklärung gebe, nebeneinander her und seien in sich autonom, entwickelten sich der Logik dieses Ereignisses gemäß. Diese fast ein wenig an Luhmanns Systemtheorie erinnernde Position unterscheidet sich sichtlich von der eher machttheoretischen Methodik der späteren Schriften Foucaults. Macht spielt hier noch überhaupt keine Rolle. Es liegt nahe zu vermuten, dass es die Ereignisse von 1968 waren, die Foucault erst dazu führten, seine Methodik stärker zu politisieren und die Frage nach der Verquickung von Wissen und Macht zu stellen.
Foucault Anspruch ist jedenfalls: „Indem man diese Art [von Diskurs] betrachtet, gelangt man zu einer exakten Deduktion der Hauptbegriffe und -themen der Philosophie, die in der Geschichte unserer Kultur aufgetreten sind“ (60). Seit Descartes variiere die Philosophie unentwegt dieselben Grundpositionen zum Verhältnis von Subjekt und Wahrheit, die Foucault im eigentlichen Hauptteil des Buches ab dem 6. Kapitel durchdekliniert und sogar behauptet, dass ihre zeitliche Reihenfolge sich aus dem Auftauchen des Cogito präzise ableiten ließe.
Diese Kapitel überraschen und erinnern wiederum eher an Hegels Philosophiegeschichtsschreibung als an den Foucault, den man meinte zu kennen. War das entscheidende Movens der Philosophiegeschichte also nicht, wie man gemeinhin geneigt ist zu glauben, externe politische Ereignisse, kulturelle Verschiebungen oder Fortschritte der Wissenschaft, sondern folgte sie allein einer internen Dialektik, die seit dem 17. Jahrhundert feststand? Das behauptet jedenfalls Foucault und dekliniert diese Logik in der Folge minutiös durch. Für Philosophiehistoriker sind diese Kapitel aufgrund ihrer durchaus originellen Sichtweise von großem Interesse, auch wenn man oftmals den Eindruck gewinnt, dass Foucault nur bereits von anderen Gesagtes im Rahmen seiner Methodik umformuliert (schon, dass mit Descartes ein ganz neues Zeitalter der Philosophie begann, ist ja ein locus communis der Philosophiehistorie).
Foucault diskutiert in der Folge ausgiebig seine eigene Methodologie (vgl. Kap. 10) und geht dann dazu über, das „Ereignis Nietzsche“ zu beschreiben. Denn mit ihm sei die Strahlkraft des „Ereignisses Descartes“ erloschen, und wir befänden uns in einer ganz neuen Ära – was es uns überhaupt erst ermögliche, den post-cartesianischen Diskurs umfassend beschreiben zu können (wieder eine Hegelsche Denkfigur!). Und wieder wird deutlich, dass sich Foucault selbst als Philosoph sieht, wenn er von der „rein diagnostische[n] Frage“ (199) spricht: „Was geschieht also heute, in diesem singulären Jetzt, in dem man von der Philosophie als einer einfachen Diskursform spricht?“ (ebd.) Dabei geht es Foucault durchaus darum, die Philosophie zu retten, insofern er die Alternative von „endgültige[m] Verschwinden“ (201) und „radikale[m] Neuanfang als ein zweiter Morgen“ (202) pointiert.
Wie schon diese metaphorische Wendung in dem bislang ausgesprochen trocken geschriebenen Buch erahnen lässt, wird es nun – eher im Einklang mit Foucaults sonstigen Schriften – ein wenig lebendiger, aber zugleich auch nebulöser. Mit Nietzsche werde jedenfalls das Projekt der Suche nach einer Kongruenz von Wahrheit und Partikularität im Akt des philosophischen Sprechens aufgegeben, womit vor allem die Differenz von Philosophie und Literatur sich verflüssige – aber auch diejenige von Philosophie und Religion: „[I]n diesem Sinne wird der philosophische Diskurs vom religiösen Diskurs nicht so weit entfernt sein: aber keine Exegese; das Wort Christi selbst“ (208). Das Subjekt, von Descartes bis Husserl das Fundament der „abendländischen“ Philosophie, löse sich auf und weiche einer „Vielheit von Subjekten“ (212), einem „große[n] Pluralismus“ (213), den Foucault insbesondere mit den Namen Bataille und Artaud verknüpft. An die Stelle eines einheitlichen Subjekts des philosophischen Diskurses trete „eine nicht entzifferbare Vielheit von Masken oder Gesichtern“ (ebd.), die strikte Unterscheidung von Wahnsinn und vernünftiger Rede werde ebenso unmöglich. Foucault denkt dabei natürlich vor allem an Nietzsches Ecce homo.
Im 12. Kapitel fährt Foucault in seiner Analyse des „Denken[s] nach Nietzsche“ (224) fort und behauptet die Abkehr von den Grundannahmen der Tradition von Descartes bis Husserl als wesentlichen Grundzug der unterschiedlichen Strömungen des gegenwärtigen Denkens vom Positivismus bis zu Heidegger. Man wende sich vom Subjekt ab und hin zur Sprache bzw., in seiner Terminologie, dem „Diskurs“.
Letzteren Begriff versucht Foucault im 13. Kapitel des Buches näher zu bestimmen und reflektiert wiederum seine eigene Methodologie. Dieses Kapitel ist aufschlussreich und hier spricht Foucault wieder sehr anders als in seinen bekannten Schriften, scheint darauf abzuzielen, eine klare Methodik der Diskursanalyse zu begründen, die der Beschreibung der Dialektik vom „Diskurs“ als der Gesamtheit von demjenigen, was in einer Kultur geäußert wird, und dem „Archiv“ als demjenigen, was von jenem Diskurs aufbewahrt wird und wiederum auf den Diskurs rückwirkt, dient: dem „Diskurs-Archiv“ (255). Dabei betont er klar, dass eine Beschreibung der Gesamtheit eines Diskurses aus logischen Gründen unmöglich sei – wie auch diejenige der Beschreibung der Diskurse fremder Kulturen, die stets die Kategorien des eigenen Diskurses voraussetze. Es gebe mithin kein Außen des Diskurses – „Der Diskurs findet nur im Diskurs statt“ (254) – und die verschiedenen Unterdiskurse bildeten „mit den Bedingungen, die sie aufrechterhalten, sortieren und zirkulieren lassen, ein untrennbares, kohärentes Ganzes …, das seine Autonomie hat“ (ebd.). Auch hier klingt Foucault wieder überraschend systemtheoretisch bzw. luhmannianisch und vor allem, im Gegensatz zu seinen späteren Schriften, äußerst sprachfixiert, um nicht zu sagen „logozentrisch“.
Diese neue Methode, die anscheinend an die Stelle der alten Philosophie und insbesondere auch der Ideologiekritik treten soll, fasst Foucault als „Archäologie“ (S. 262). Sie soll der Beschreibung jenes Diskurs-Archivs dienen, das „sowohl eine irreduzible Zwischeninstanz als auch der gemeinsame Ort, in dem alle Unterscheidungen wurzeln“ fungiert, der „universelle Zwischenraum“ (ebd.). Es handele sich um eine, freilich nie totale, „immanente Ethnologie“ (S. 267), in der es vor allem um eine Beschreibung der Entwicklung der unterschiedlichen Systeme der Archivierung gehe, deren Grundzüge bezogen auf das „Abendland“ Foucault im 14. Kapitel skizziert.
Diese neue philosophische Position bekräftigt Foucault dann im 15. Kapitel noch einmal. Zumindest für die Gegenwart diagnostiziert er: „Das Nicht-Diskursive erscheint und konstituiert sich nunmehr zwischen den Achsen des Diskurses. Heute findet alles seine Möglichkeit im Diskurs: Die Erfahrung, die Realität, die Existenz, die Subjektivität, das Sein sind nichts anderes als diskursive Figuren“ (287), Und der Schlusssatz: „Unter diesen Umständen ist ersichtlich, dass nur das, was Diskurs ist, existieren und der Erfahrung gegeben werden kann. Die Diskursivität, durch die sich die Erfahrung definiert und die ihr ihre Möglichkeit verleiht, kommt immer nur dem Diskurs selbst zu“ (290).
Wie erwähnt, erweckt der Text nicht den Eindruck, am Ende rund und abgeschlossen zu sein. Das von Artaud und Bataille entlehnte Pathos der dionysischen Desubjektivierung und die bemüht nüchterne Methodik der Diskursanalyse scheinen nicht ganz vereinbar zu sein, zumal letztere den Verdacht aufwirft, dass Foucault hier den traditionellen Diskurs der „abendländischen“ Philosophie einfach fortsetzt: Er sucht weiterhin nach einem „identischen Subjekt-Objekt“ (Lukács) als absoluter Grundkategorie, aus der sich dann die Totalität des gesamten Seins entschlüsseln ließe; der „absolute Geist“ feiert in Gestalt des „Diskurs-Archivs“ seine Wiederauferstehung. Vielleicht haderte Foucault mit diesen Schwachpunkten selbst und brach sein Projekt aus diesem Grund ab.
1966 hätte Foucaults Werk äußerst radikal gewirkt, heute wirkt es nicht mehr so originell, sondern eher wie ein recht typisches Dokument der Periode des heroischen Postmodernismus, in der Autoren wie Foucault, Deleuze, Lyotard und Derrida in der Form bemerkenswerter großer Erzählungen wie derjenigen, die Foucault hier entwarf, das „Ende der großen Erzählungen“ verkündeten. Die Eckpunkte von Foucaults Metanarrativ sind schon längst Teil des heute gültigen „Archivs“ geworden und schockieren niemanden mehr, sie wirken fast ein wenig wie Plattitüden. Dies gilt nicht zuletzt für den philosophischen Diskurs, in dem selbst Foucaults Antipoden wie Habermas und seine Anhänger – oder nahezu zeitgleich mit ihm Adorno in der Negativen Dialektik – mehr oder weniger darin übereinstimmen würden, dass die postcartesianische Ära der Philosophie zu Ende sei und mit Nietzsche etwas vollkommen Neues begonnen habe, dass sich Philosophie nun primär auf Gegenwartsdiagnostik und Sprach- bzw. eben Diskursanalyse zu beschränken habe.
Wenn Foucault etwa spöttisch bemerkt, dass die „klassische“ Philosophie bereits nach 300 Jahren an ihr Ende gekommen sei, ist man fast versucht zu erwidern: Jenes Philosophieverständnis wirkt schon jetzt, nur wenige Jahrzehnte später, als an ein Ende gekommen und erschöpft. Mit dem „Neuen Materialismus“ hat sich längst eine neue Version des heroischen Postmodernismus akademisch etabliert, die dessen Grundgestus wiederholt und sich um eine noch stärkere Desubjektivierung bemüht. Strenger Szientismus und Hang zum Irrationalen paaren sich auch hier wieder und werden fast ununterscheidbar. Zugleich scheint sich eine gewisse antipostmodernistische Opposition zu formieren, die für die Reaktualisierung der modernen Philosophie und ihrer Problemstellungen streitet – wie insbesondere der Frage nach dem Subjekt –, und die vielleicht gar für eine Renaissance des philosophischen Marxismus sorgen könnte. Der Deutung Nietzsches kommt in diesem Kulturkampf eine zweifellos zentrale Rolle zu: Ist er ein Apologet der von Foucault bis Latour gefeierten Desubjektivierung oder nicht eher deren Diagnostiker, dessen Schriften sich ein Appell für neue Weisen der Subjektivierung entnehmen lässt? Wobei klar ist: Von dem „Ereignis Nietzsche“ dürfte sich die Philosophie auf lange Zeit nicht mehr erholen, insoweit ist Foucaults Diagnose zuzustimmen. Ob sie sich nur als logozentrische „Archäologie“ betreiben lässt, darf bezweifelt werden.
Der entscheidendste Umbruch, der uns von Foucault trennt, dürfte freilich der völlig neue Modus der Archivierung sein, dem wir unterliegen. Auch wenn man die verschiedenen Weisen der Archivierung für nicht so zentral für die kulturellen Gesamtformationen halten mag wie Foucault, sind seine diesbezüglichen Überlegungen und seine Skizze der Geschichte der „abendländischen“ Kultur- als Archivgeschichte äußerst erhellend. Geht er bereits für seine Gegenwart von der Emergenz „eines integralen Archivs“ (282) aus, in dem sich die Grenzen zwischen Diskurs und Archiv zunehmen auflösen und mithin „der Horizont des Archivs … unbestimmt“ (282) werde – eine durchaus nietzscheanische Diagnose –, leben wir heute in einem ganz neuen Regime der Archivierung, und was das bedeutet, ist noch völlig unabsehbar. Das analoge wird mehr und mehr durch ein rein digitales Archiv ersetzt, dessen Regeln von Statistik und Algorithmen definiert werden. Im Internet freilich sind Diskurs und Archiv vollkommen ununterscheidbar geworden, und der analoge Diskurs erscheint mehr und mehr als ein unwirklicher Schatten des digitalen. Foucaults Konzept des „Diskurs-Archivs“ mag seine Schwachpunkte haben, doch ruft es den Leser dazu auf, sich selbst als „Diagnostiker“ zu betätigen und sich über diese Entwicklungen Gedanken zu machen.