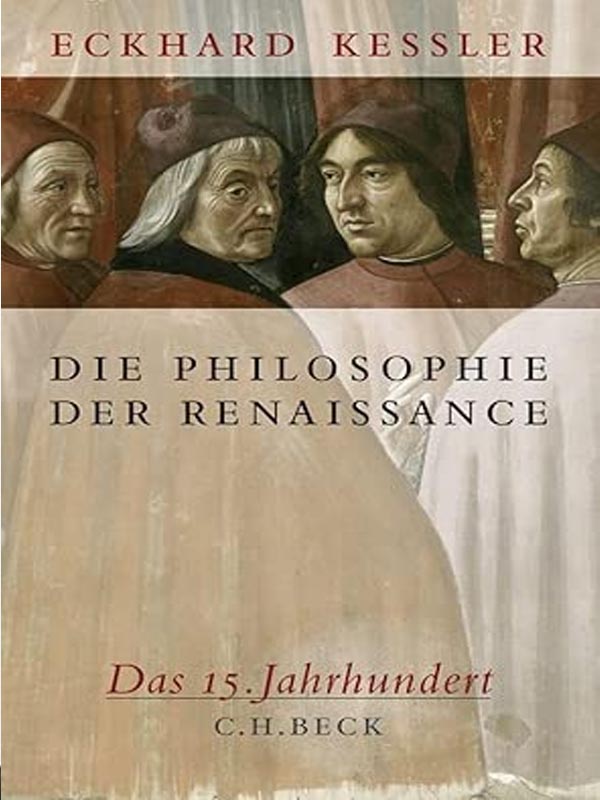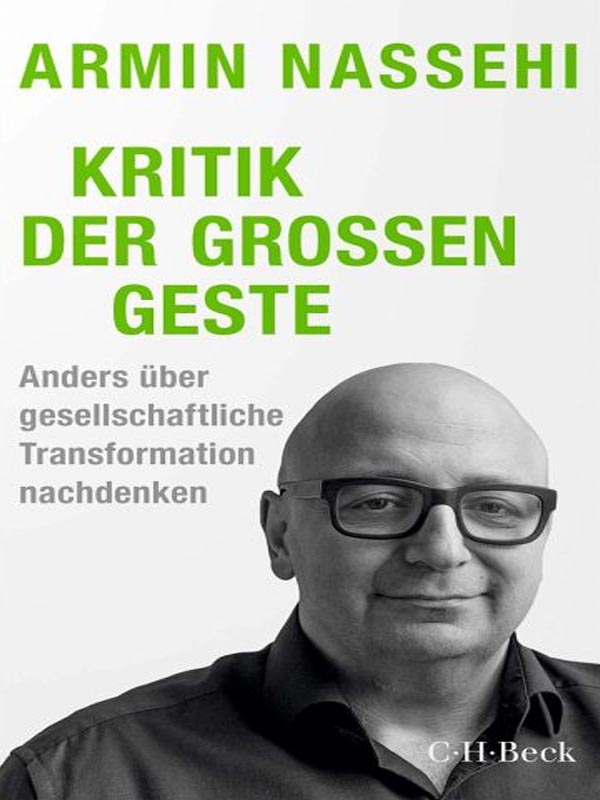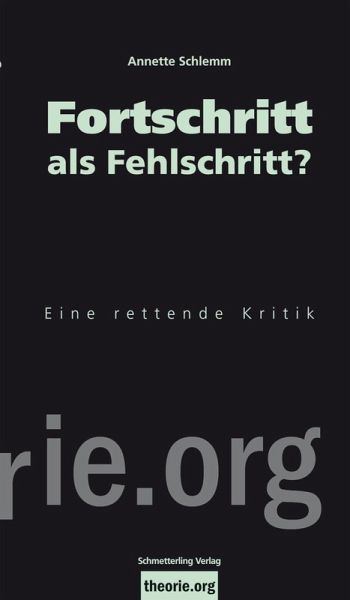Eckhard Keßler (1938-2018) studierte von 1958-59 Klassische Philologie und Philosophie in Tübingen und bis 1963 an der LMU. Nach der Promotion habilitierte er dort 1975 in Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus. Er war 1977 Gastprofessor an der Columbia University New York und von 1979 bis 1982 Direktor des Deutschen Studienzentrums in Venedig. 1980 wurde er in München zum Professor für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus berufen und im Jahre 2004 emeritiert. Seine Forschungsschwerpunkte waren die Naturphilosophie und Methodendiskussion im 16. Jahrhundert sowie die Tradition des Aristotelismus.
Der Aufforderung der Redaktion des „Widerspruch“ über mich selbst zu schreiben – woher ich komme, was ich mache, und warum ich mache, was ich mache – folge ich mit Zögern. Das persönliche Tun und Lassen, Wollen und Sollen scheint als das Individuelle mit der Sache der Philosophie wenig zu tun zu haben, und wenn es etwas gibt, das von allgemeinerem Interesse sein könnte, dann müsste es in den philosophischen Versuchen selbst deutlich geworden und dort jedem, der es kennen will, zugänglich sein.
Aber dann erinnerte ich mich, dass immer wieder in der Geschichte des westlichen Denkens in Zeiten der Krise und der Desorientierung, wenn die Normen fragwürdig wurden und das Allgemeine seine Verbindlichkeit verlor, das Besondere gesucht und dem Faktischen vertraut wurde. Das Biographische und Autobiographische, das tatsächlich Gelebte und Erlebte trat an die Stelle des nur Gedachten: in der Spätantike, in der Renaissance, in der frühen Neuzeit. Ich denke in der Philosophie an die Aufmerksamkeit, mit der die Selbstdarstellungen von Augustinus und Petrarca, Cardano und Rousseau studiert wurden, an die Unternehmungen von Hugo Grotius im 17. und dem Italiener Gian Artico di Porcia im 18. und an ähnliche Initiativen in den USA und Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die philosophierenden Zeitgenossen zu Selbstdarstellungen zu bewegen und wenn nicht Muster vorbildlicher, so doch Fallstudien möglicher philosophischer Lebenswege und ihrer Konsequenzen zu präsentieren. Warum sollten nicht auch in unserer Gegenwart, in der die Philosophie doppelt herausgefordert ist, sich in der ihr zunehmend feindlich gesinnten Umwelt zu behaupten und zugleich diese neue Realität zu reflektieren und zu erklären – warum also sollte nicht auch in unserer Gegenwart das, was andere erfahren haben, eine Orientierungsfunktion übernehmen können?
Nun denn, was mich angeht, so will ich es versuchen.
1. Ich bin weder als Philosoph geboren noch zum Philosophen erzogen worden. Der westfälische Vater war Ingenieur und während der ersten sieben Jahre eine überlebensgroße Gestalt am fernen Horizont des Krieges. Die schlesische Mutter machte in der Behandlung der beiden Töchter und des Sohnes keine großen Unterschiede. Ich erinnere mich an die gespannte Atmosphäre am Tag nach dem 20. Juli 1944 und an ein Hitlerlied, das mir noch in den ersten Schulmonaten beigebracht wurde. Daran schloss sich eine lange Flucht aus Schlesien, begleitet von goyaesken Gestalten, und ein noch längerer Abenteuersommer, -herbst und -winter in einer zerbombten westfälischen Stadt: wilde Spiele zwischen den Trümmern, den rätselhaften Zeugnissen vergangenen Lebens. Was keinen Sinn machte, wurde zerlegt, zerbrochen, zerschlagen. Wir waren keine Archäologen.
Die Schule öffnete wieder im Frühjahr 1946. Sie wurde von dem beinahe Achtjährigen freudig begrüßt. Angesichts der überwältigenden Vielfalt zumeist unzusammenhängender Eindrücke war das Verlangen nach Aufklärung, Ordnung, Verstehen drängend geworden. Ohne Radio und Bücher, mit einem vierseitigen Wochenblatt als Informationsquelle wurde die Schule zum Tor zu einer Welt jenseits des unmittelbar Gegebenen. Sie versprach, der fragmentarisierten Gegenwart einen Kontext zu geben: ein Vorher, als die Welt noch heil war, und ein Nachher, in dem die Welt wieder heil sein konnte. Die Schule war keine Störung kindlicher Spielseligkeit, aber auch keine Flucht in ein abgehobenes Reich reinen Wissens, sondern der Ort, wo die Mittel erworben werden konnten für die innere und äußere Lebensbewältigung.
Rückblickend halte ich es für möglich, dass diese Einschätzung der Welt des Geistes bei meiner ersten Begegnung mit ihr für die Schwierigkeiten verantwortlich ist, die ich bis heute mit der Selbstzweckhaftigkeit des bíos theoretikós bei Aristoteles und allen, die ihm folgen, habe und für die große Sympathie, die ich spontan für alle Positionen empfinde, die, wie etwa Cicero in De officiis, von der Philosophie verlangen, sich gegenüber den Anforderungen des menschlichen Lebens zu bewähren.
2. Der erste auf bewusster Wahl beruhende Schritt – wenn auch in anderer Absicht unternommen – war der Entschluss zum Besuch des humanistischen Gymnasiums. Er konnte meinem Vater, der mich in seine Fußstapfen treten sehen wollte, unter Berufung auf Heisenbergs Feststellung, dass Humanisten die erfolgreicheren Naturwissenschaftler zu sein pflegten, abgerungen werden. Damit öffnete sich mir die Weite der abendländischen Kultur, die mit Homer und Hesiod und den Vorsokratikern beginnt und ihr Zentrum im Mittelmeerraum besitzt, gestützt auf die drei Wurzeln Athen, Rom und Jerusalem. Sie wurde nach langen Jahren der Annäherung endlich zu meiner Welt: der natürliche Raum meines Denkens. Die Vorstellung, auf sie verzichten zu müssen, ist schwer erträglich; der Gedanke, dass jemand freiwillig das Angebot, sie zu erwerben, ausschlägt, unverständlich. Später, in den USA, habe ich gelernt, wie borniert eine solche eurozentrische Perspektive ist. Ich habe sie daraufhin in meinem Bewusstsein relativiert, aber nicht aufgegeben.
In diesem Zeit-Raum der europäischen Tradition erhalten die Erfahrungen der Gegenwart historische Tiefe: die Weisen der Erfahrung nicht anders als ihre Gegenstände verlieren die Absolutheit schlechthinniger Gegebenheit; sie sind nicht einfach hinzunehmen, sondern können nach ihrer Ursache befragt und in ihrer Genese verstanden werden. Das ist die alte Frage der Kinder, der Narren und der Philosophen.
Aber nicht nur rückwärts gewandt erstreckt sich diese historische Tiefe und fordert – der Flug der Eule der Minerva in der Dämmerung – zu nachträglicher Legitimation und Erklärung des Gewordenen und Getanen auf, sondern auch vorwärts gewandt lehrt sie, dass die Dinge im Prozess ständiger Veränderung stehen und dass der Mensch an dieser Veränderung beteiligt ist und für sie Verantwortung übernehmen muss.
3. Der zweite richtungsweisende Schritt, die Studienwahl, widersprach zwar den väterlichen Träumen, war aber vorhersehbar geworden: nicht die Natur-, sondern die Geisteswissenschaften und hier vor allem Klassische Philologie, mit Germanistik fürs Lehramt und Philosophie für die „Weltweisheit“.
Die ersten beiden Semester in Tübingen, drei atemberaubende Lehrer: der Gräzist Wolfgang Schadewaldt, der Latinist Ernst Zinn, der noch junge Literat und spätere Rhetorik-Professor Walter Jens; der erste würdevoll, der letzte intellektuell brillierend, der mittlere von größtem Einfluss: mit leiser Stimme stellte er die Frage: „Warum?“. Warum studieren wir die Antike? Warum wurde sie nach ihrem Ende in immer neuen Renaissancen immer wieder neu belebt?
Mit dieser Frage zog ich zum dritten Semester, 1959, für zwei Semester nach München zu den Klassischen Philologen Rudolf Pfeiffer, Friedrich Klingner, Kurt von Fritz. Obwohl ich mich immer als Latinist verstanden hatte und mich auch im Staatsexamen hatte prüfen lassen, wurde Kurt von Fritz mein philologischer Lehrer. Bei ihm lernte ich, Aristoteles zu lesen: nicht den Autor der aristotelischen Lehre, sondern den Autor der Fragen, die die aristotelische Lehre zu beantworten sucht.
Im Gepäck hatte ich auch die Empfehlung eines juristischen Freundes, den Philosophen Ernesto Grassi keinesfalls zu versäumen. Er las „Das Problem des Beginns des modernen Denkens und die Philosophie der Renaissance“, wobei er zu zeigen versuchte, dass das moderne Denken seinen Ursprung nicht bei Descartes, sondern in der Renaissance hatte. Das war keine direkte Antwort auf die von Ernst Zinn gestellte Frage; aber was ich hörte, reichte aus, um sie zur Frage nach dem Warum nicht nur der Klassischen Philologie, sondern des modernen Denkens überhaupt zu erweitern und die Antwort in jener Renaissance zu suchen, von der Grassi gesprochen hatte.
Statt nach Tübingen zurückzukehren, begann ich für und bei Ernesto Grassi zu arbeiten. Nach dem Staatsexamen in Klassischer Philologie und Germanistik promovierte ich bei ihm über ein Thema zur Philosophie des frühen Humanismus und habilitierte mich schließlich mit einer Arbeit, die ursprünglich das Geschichtsdenken des italienischen Humanismus als ganzen zum Gegenstand haben sollte, dann aber nicht über den ersten Humanisten, Petrarca, hinauskam. Die Jahre ihrer Entstehung – von 1968 bis 1974 – waren nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht für mein Leben und Denken prägend. Als Hilfskraft erst, dann als Assistent war ich am Aufbau des „Seminars für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus“ beteiligt. Nach Grassis Emeritierung wurde daraus im Zuge der Universitätsreform von 1974 das „Institut für Geistesgeschichte und Philosophie“ erst „des Humanismus“, später dann „der Renaissance“. Nun wird es, im Zuge der Universitätsreform von 1998, wieder zu einem Seminar, diesmal „für Geistesgeschichte und Philosophie der Renaissance“ im Rahmen des „Instituts für Philosophie“.
4. Das Münchner Institut bzw. Seminar ist das einzige in Deutschland, das sich ausdrücklich mit der Renaissance-Philosophie beschäftigt. So war es nur natürlich, dass ich mich, mit ihm seit seiner Gründung verbunden, in meiner Forschung und Lehre beinahe ausschließlich auf deren Geschichte und Probleme konzentriert habe. Dies bedeutet eine gewisse Isolation an der eigenen Universität, motiviert aber gleichzeitig auch zu vermehrten internationalen Kontakten, um der Gefahr der Provinzialisierung zu begegnen. Mich haben sie zu längeren Aufenthalten in den USA und Italien und zu freundschaftlichen Kooperationen mit Kollegen aus fast allen europäischen und vielen außereuropäischen Ländern geführt, die für meine Arbeit von großer Bedeutung waren.
In der Lehre war ich vom Beginn meiner Vorlesungstätigkeit an darauf bedacht, meinen Hörern, gleichgültig ob aus der Philosophie oder aus anderen Fächern, das zu vermitteln, was ich selbst als Student immer vermisst hatte: eine dokumentierte Kenntnis der Strömungen und Probleme der Philosophie zwischen etwa 1350 und 1600 in ihrem philosophiehistorischen, kulturellen, politischen und sozialen Kontext. Entgegen meiner Herkunft aus der Klassischen Philologie habe ich dabei die unmittelbar vorhergehenden, spätmittelalterlichen Anstöße, vor allem Duns Scotus und Wilhelm von Ockham, betont, in deren Licht die neue Rezeption der Antike vorgenommen wurde und verständlich zu werden scheint.
In meiner Forschung, die nicht ohne den Dialog mit den Studenten in den Seminaren denkbar ist, stand zunächst die Frage nach den Wurzeln und der Entstehung der neuzeitlichen Philosophie und Wissenschaft aus der „Selbstdestruktion des Mittelalters“ und der Vielfalt der in der Renaissance entwickelten Ansätze im Vordergrund: die anthropologischen und moralphilosophischen Versuche im Umkreis der Humanisten, die kosmologischen und naturphilosophischen Entwürfe in der Tradition der Aristoteliker und des Neuplatonismus, die umfangreiche erkenntnistheoretische Diskussion in der Auseinandersetzung mit der aristotelischen Psychologie und die vielgestaltige Methodendiskussion im Ausgang vom deduktiven Wissenschaftsideal des Aristoteles, auf der Suche nach einer empirisch begründeten „neuen Wissenschaft“. Dabei verschob sich im Laufe der Jahre die leitende Perspektive: an die Stelle der genetischen Begründung der modernen Philosophie und Wissenschaft, die man als Perspektive einer diachronen Wissenschaftstheorie bezeichnen könnte, trat die Analyse der Problemstellungen und Lösungsansätzen als Manifestationen des Denkens, unabhängig von ihrer historischen Relevanz, die man die Perspektive einer diachronen Phänomenologie des menschlichen Geistes nennen könnte.
5. Seit der Zeit, als ich mich in München ernsthaft auf die Philosophie einzulassen begonnen habe, hat die Philosophie selbst sich verändert. Diese Veränderungen haben ihre Gründe und müssen – man mag sie begrüßen oder nicht – in ihrer Faktizität akzeptiert werden. Wir können aber weder hoffen noch müssen wir befürchten, dass sie der Philosophie ihre endgültige Gestalt gegeben haben, und es steht uns frei, an ihrer Zukunft mitzuwirken. Ich möchte abschließend dazu zwei Anmerkungen machen:
[1] Ich halte in der gegenwärtigen innerphilosophischen Diskussion die Differenzierung nach historischen Problemen und Sachfragen nicht für besonders hilfreich. Denn einerseits sind alle unsere Fragen geschichtlich und das, was eine Sache ist, ist der Philosophie nicht vorgegeben, sondern von ihr selbst definiert; und andererseits ist so etwas wie eine reine, nicht von ihrem Erzähler gedeutete Geschichte in der Philosophie ebenso wenig möglich wie in anderen Bereichen.
[2] Ich halte in der gegenwärtigen universitätspolitischen Diskussion die Bestrebungen, die Philosophie auf ein berufsbildendes Fach zu reduzieren und ihre Effizienz nach der Zahl der Studienabschlüsse zu bemessen, für verfehlt. Zwar muss auch die Philosophie dem gewachsenen Bedürfnis der Studierenden nach klarer Strukturierung und größerer Regulierung der Studiengänge gerecht werden, aber sie darf nicht auf die Vermittlung eines abgeschlossenen und abprüfbaren Wissens reduziert werden. Die Philosophie sollte sich der ihr eigenen Kreativität, immer neue Perspektiven zu eröffnen und neue Horizonte zu entwerfen, nicht berauben lassen.