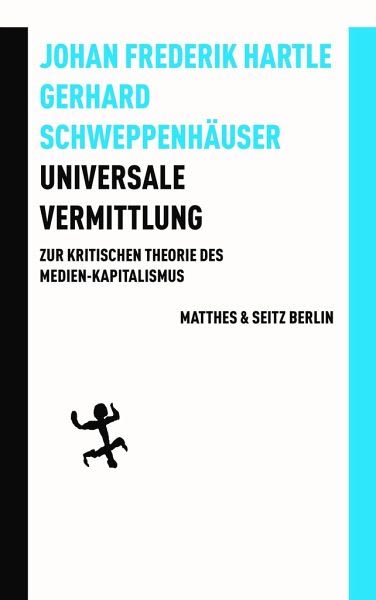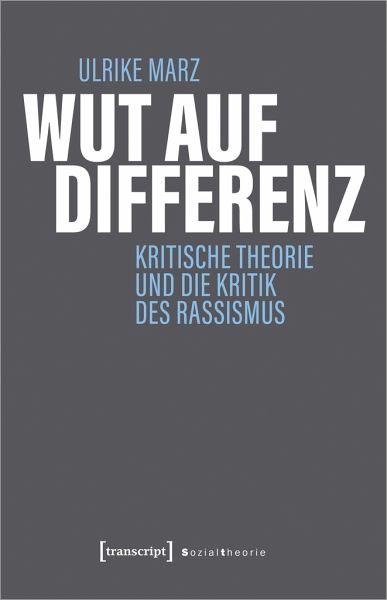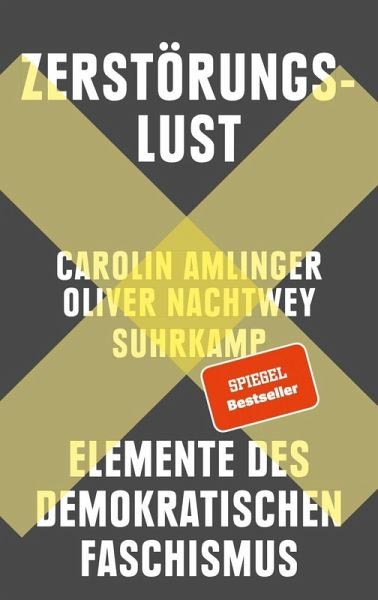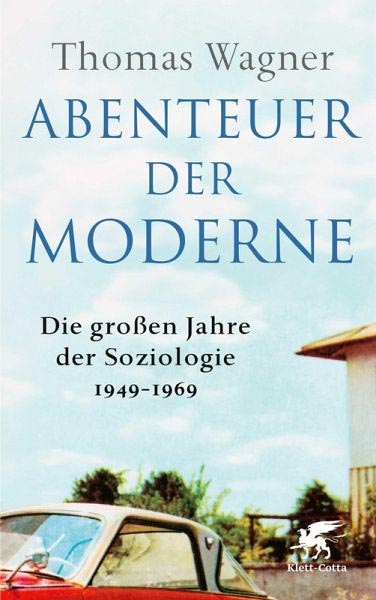Michael Kühnlein (Hg)
Singularitäten?
Im interdisziplinären Gespräch mit Andreas Reckwitz
Tb., 211 Seiten, 29,- €
Baden-Baden 2025 (Nomos-Verlag)
von Paul Stephan
Andreas Reckwitz, Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der HU Berlin, ist neben Hartmut Rosa wohl einer der meistzitierten und -diskutierten deutschen Soziologen der Gegenwart. Insbesondere seine 2017 bei Suhrkamp erschienene Studie Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne wurde nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im Feuilleton breit diskutiert und der von ihm hier geprägte Begriff der „Singularität“ immer wieder als Schlagwort bemüht. Ihre These: Seit den 1980er Jahren kam es in den westlichen Gesellschaften zu einer tiefgreifenden gesamtkulturellen Verschiebung von einer Wertschätzung des Allgemeinen, wie sie typisch für die klassische Moderne gewesen sei, hin zu einer Präferenz des Besonderen, eben des Singulären, womit Reckwitz allerdings, und darin dürfte die eigentliche Originalität seiner Diagnose bestehen, nicht bloß die von zahllosen Theorien der Gegenwart beschriebene Individualisierung, sondern eine umfassendere kollektive Suche nach dem Einzigartigen nicht nur von Personen, sondern Objekten aller Art, von Landschaften bis hin zu Kollektiven, meint.
Reckwitz vermag es so, viel diskutierte Phänomene wie die grassierendere Erlebniskultur, die zunehmende politische Polarisierung oder das Revival religiöser Fundamentalismen auf einen eingängigen Begriff zu bringen, der obendrein noch vielfältige Anknüpfungen ermöglicht. Jede und jeder wird schnell zustimmen, dass „Singularität“ ein in unseren postmodernen Kulturen ubiquitäres Phänomen ist; zahlreiche einzelne Phänomene scheinen sich mit diesem Begriff schlüssig beschreiben zu lassen. Seine Theorie besticht zumal dadurch, dass sie nicht wertend, sondern nüchtern beschreibend daherkommt. Reckwitz orientiert sich in seinem Grundansatz eher an Luhmanns Systemtheorie als an der Kritischen Theorie.
Der vom Philosophen Michael Kühnlein verantwortete Sammelband Singularitäten? greift diese Debatte nun noch einmal auf. Er beinhaltet neben einer Einleitung des Herausgebers eine „Eröffnung“ durch Reckwitz selbst, in der er seine zentralen Thesen noch einmal selbst zusammenfasst, sowie zehn „Stellungnahmen“ von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen zur Singularitätstheorie. Abgerundet wird er dann von einem zweiten Beitrag von Reckwitz, in dem er auf die verschiedenen, von seinen Kollegen vorgebrachten Kritiken und Ergänzungen repliziert.
In seinem initialen Artikel fasst Reckwitz prägnant und konzise seine Forschungen der letzten Jahrzehnte zusammen, was ihn besonders lesenswert macht. Wichtig ist hierbei zu betonen, dass er davon ausgeht, dass für ihn der Gegensatz „eine[r] soziale[n] Logik des Allgemeinen und eine[r] soziale[n] des Besonderen, des Singulären“ (14 f.) von Beginn an, also ab dem späten 18. Jahrhundert, moderne Gesellschaften prägt: „Modern sein, heißt bis ins Extrem zu generalisieren. Es heißt aber auch … bis ins Extrem zu singularisieren“ (15). Während bis weit ins 20. Jahrhundert hinein vor allem der generalisierende Rationalismus für moderne Kulturen bestimmend gewesen sei, verkörpert etwa in der industriellen Massenproduktion, den überbordenden Bürokratien moderner Staaten, dem Funktionalismus in der Architektur bis hin zum Gleichheitsgrundsatz des modernen Rechtssystems, gewinne in der „Spätmoderne“, wie Reckwitz es nennt, die schon in der Romantik antizipierte, gegenläufige Logik des Singulären immer mehr an Attraktivität und werde zum dominanten gesellschaftlichen Orientierungssystem, das Wahrnehmung und Handeln leite. Klassische Beschreibungen der Moderne wie diejenige Webers oder der ersten Generation der Kritischen Theorie bedürften daher der Korrektur.
Der interdisziplinäre und sehr heterogene Charakter der folgenden Beiträge, fast durchweg von Professoren unterschiedlicher Fachrichtungen verfasst, macht es nicht ganz einfach, zentrale Diskussionsfäden zu benennen. In seiner Replik teilt sie Reckwitz selbst wie folgt ein (vgl. 193 f.): Einige thematisieren erstens den Begriff der Singularisierung selbst und setzen ihn in Beziehung zu anderen Konzepten wie Individualisierung und subjektive Erfahrung, andere diskutieren zweitens, inwiefern Singularisierung tatsächlich ein modernes Phänomen sei und sich nicht bereits in vormodernen Gesellschaften beobachten lasse. Hinzu kommen drittens Beiträge, die Singularisierungsprozesse in unterschiedlichen gesellschaftlichen Subsystemen untersuchen und viertens solche, die die Fragen aufwerfen, ob sich die Reckwitz’sche Theorie als Sozialdiagnose verstehen lasse, und in welchem Verhältnis sie zur Kritischen Theorie stehen – wobei Reckwitz einige Aufsätze auch mehreren dieser Kategorien zuordnet. An dieser Einteilung werde ich mich im Folgenden grob orientieren.
Der Soziologe Manfred Prisching wirft in seinem Beitrag Gemäßigte Singularität in der Tat einige wichtige Grundfragen auf. Die Reckwitz’sche Theorie als „Ausweitung der wohlbekannten These von der Individualisierung“ (117) sei eher eine Beschreibung des Selbstverständnisses spätmoderner Gesellschaften als ihrer Realität, ihrer spezifischen Ideologie, die sie nicht hinterfrage, sondern nur nochmal theoretisch reformuliere: „Es ist vielleicht diese Wolke, die Reckwitz beschreibt: nicht die Gesellschaft, sondern die Selbstbeschreibung einer Gesellschaft, die sich von der Wirklichkeit entfernt hat. Singularitätsillusion als Kompensation einer real vermassten Gesellschaft“ (131). Prisching verweist dabei etwa auf die zunehmende digitale Kontrolle der Bevölkerung und auf die zahlreichen Paradoxien des Singularitätsdiskurses, die man etwa besonders sinnfällig im Massentourismus beobachten könne: „Meist haben wir es mit einer standardisierten Einzigartigkeit zu tun“ (126). Und auch er wirft schon die Frage auf, ob das, was Reckwitz „Singularisierung“ nennt, nicht schon in früheren Gesellschaften in sehr radikaler Form existiert habe, etwa im Individualismus der Mächtigen (vgl. 118 f.).
In ein ähnliches Horn bläst auch der Germanist Erik Schilling, der in seinem Aufsatz Singularitäten und Muster der Digitalisierung unter Bezugnahme auf Armin Nassehis Studie Muster (2019) und Marc-Uwe Klings Roman QualityLand (2017) ebenfalls zu zeigen versucht, dass im digitalen Zeitalter scheinbare Singularisierung sehr wohl auf generalisierenden Prozessen der Musterbildung basiert, wenn etwa den Kunden von Webseiten „individuell zugeschnittene Produkte“ (188) auf der Basis ihrer Interaktionsdaten und sie auswertender Algorithmen präsentiert werden. Auch er hält die Singularisierung also eher für ein Scheinphänomen als eines der gesellschaftlichen Basis.
Entsprechend versucht auch der Theologe Volker Leppin im Beitrag Mystik und Visionen als Singularitäten am Beispiel „frauenmystischer Texte“ (91) zu zeigen, dass sich auch der mittelalterliche Diskurs um individuelle mystische Gotteserfahrungen von Frauen als eine Praxis der Singularisierung beschreiben lasse – und die in diesen Berichten ausgestellte Besonderheit mithin nur vor dem Hintergrund eines allgemeinen kulturellen Grundmusters funktioniere.
Der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke beginnt seinen Aufsatz Wiederkehr der Vormoderne? Varietäten des Liberalismus in einer postsouveränen Welt mit einigen skeptischen Erwägungen darüber, inwieweit sich die auch von Reckwitz vor allem mit der Ideologie der neuen Mittelschicht assoziierte neue Wertschätzung der Singularität überhaupt zu einer globalen Gesamtdiagnose über die Gesellschaft verallgemeinern lasse, und inwiefern wir es gegenwärtig nicht eher mit einer Rückkehr vormoderner Muster auf globaler wie auch mikrologischer Ebene zu tun hätten im Zuge der Auflösung der im 19. Jahrhundert etablierten nationalstaatlichen Demokratien und ihrer Ersetzung durch imperiale Strukturen, in der die staatlich garantierte Gleichheit durch eine Verstrickung der Individuen in ein Netz vielfältiger Abhängigkeiten und Hierarchien ersetzt werde.
Auch der Theologe Claas Cordemann erblickt in der Singularisierung des Sozialen in seinem Artikel Die Religion der Singularitäten eine primär zu kritisierende Tendenz, gerade weil sie sich selbst aufhebe: Da Singularisierung Allgemeinheit voraussetze, zerstöre eine unbeschränkte Singularisierung nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern werde in sich selbstwidersprüchlich. Einen Ausweg skizziere die religiöse Erfahrung des Singulären, in der die singuläre Erfahrung des Heiligen zugleich auf ein Allgemeines verweise. Den Kirchen komme die Rolle zu, diesen intrinsischen Zusammenhang von Singularität und Allgemeinem immer wieder herauszustellen und die gesellschaftlichen Fliehkräfte dadurch zu bändigen.
Diese eher kritischen Beiträge kontrastieren mit denjenigen von Armin Steinbach Das Amt in einer Gesellschaft der Singularitäten, von Thomas Vesting Die Theorie der Singularisierung und die Evolution des Rechts in der Moderne sowie von Birger P. Priddat Über eine Ökonomie der Kreativitätszumutungen. Sie alle knüpfen mehr oder weniger unkritisch an Reckwitz’ Theorie an und wenden sie ihrer jeweiligen fachlichen Spezialisierung entsprechend auf spezifische Phänomene an: auf die Erwartungen an politische Amtsträger, die Änderungen im Rechtssystem und die zeitgenössische Kreativindustrie.
Der Soziologe Mikael Carleheden und der Herausgeber des Bandes nehmen Reckwitz gegenüber hingegen wiederum eine kritische Stoßrichtung ein. In seinem Aufsatz How to theorize structural transformation: Diagnosis of the times or theory of society? betont Carleheden zunächst, dass Reckwitz seine Theorie dezidiert nicht als Zeitdiagnose verstanden wissen möchte. Während eine Zeitdiagnose die Grundtendenzen einer Gesellschaft umfassend zu beschreiben versuche, um Möglichkeit einer Veränderung zum Besseren aufzuzeigen, und sich insofern zwischen wissenschaftlicher Soziologie und breiter Öffentlichkeit positioniere, beanspruche Reckwitz zwar gleichfalls, ein großes Gesamtbild der Gesellschaft zu entwerfen, gehe jedoch von einem dualistischen Verständnis zwischen Soziologie und Öffentlichkeit aus – trotz der erwähnten Breitenwirkung seiner Theorien – und belasse es dezidiert bei einer reinen Analyse, ohne irgendeine Kritik an den beschriebenen Phänomenen zu äußern.
Kühnlein nun versucht in seinem Text Wie besonders ist das Besondere? Zum Verhältnis von Gewalt und Singularität bei Andreas Reckwitz zum einen zu zeigen, dass dessen Theorien durchaus eine kritische „humanistische Pointe“ (108) aufweisen, insofern sie selbst immer wieder die gesellschaftliche Vermitteltheit und mithin Allgemeinheit des Besonderen aufzeigten und insofern die irrationalistische Verabsolutierung des Besonderen zur höheren Wahrheit – wie sie in der Philosophie etwa bei Kierkegaard, Carl Schmitt und Derrida betrieben werde (vgl. 107 f.) – als ideologische Mystifikation kenntlich mache. Zugleich stellt er jedoch die Frage, ob Reckwitz damit nicht den eigentlichen Witz des modernen Authentizitätsdenkens verfehlt, insofern seine Theorie keine klare Differenzierung „zwischen erfolgreicher Selbstvermarktung und authentischer Selbstverwirklichung“ (110) zulasse. Seine Theorie könne mithin nur die gesellschaftliche Bewertung des Singulären erfassen, „nicht jedoch das Singuläre selbst“ (111). Sie scheitere jedoch insbesondere daran, die brutale Seite der Singularisierung hinreichend zu benennen und zu analysieren, die sich etwa im Terrorismus äußere, in den ein von jedweder Allgemeinheit abgekoppeltes Singuläres stets abzugleiten drohe. Es bedürfe dazu einer Explizierung ihres normativen Kerns, um sie zu einer wirklich kritischen Theorie der Singularisierung zu machen.
Der Sammelband vermittelt so einen sehr guten Überblick über Reckwitz‘ Singularisierungstheorie und den Stand der wissenschaftlichen Debatte um sie; ihre Schwächen, aber auch ihre Stärken. Jedem, der sich für Reckwitz’ Theorie im Besonderen und den gegenwärtigen Stand der sozialtheoretischen Diskussion im Allgemeinen interessiert, kann der recht schmale Band daher sehr zur Lektüre empfohlen werden.
Die zentrale These von Reckwitz scheint geradezu unabweisbar zu sein oder weist zumindest eine große lebensweltliche Plausibilität auf. Wir stoßen in unserer alltäglichen Erfahrung immer wieder auf Phänomene der Singularisierung – die sich freilich im politischen Bereich vor allem in einem angsteinflößenden Revival partikularistischer Ideologien und entsprechender affektgeleiteter politischer Bewegungen manifestiert, in einer zunehmenden Erosion der normativen Ordnung der klassischen Moderne. Diese Entwicklung ist umso erschreckender als sich auch der historische Faschismus ja als eine Form der Rebellion im Namen der Singularität – des Volkes, der „Rasse“, der Bewegung, des „Führers“ – mitsamt der entsprechenden ästhetischen Inszenierung fassen lässt. Diese offenkundige, im Sammelband jedoch bemerkenswerterweise gänzlich ausgeklammerte Parallele lässt Reckwitz’ betont ‚nüchterne‘ Perspektive geradezu zynisch erscheinen und provoziert aus sich selber heraus die Frage, ob es nicht doch weiterführt, normative Fragestellungen nicht derart aus der Soziologie fernzuhalten, wie Reckwitz es vorschwebt.
Zu betonen wäre, dass das Bedürfnis nach Singularisierung in seiner modernen Form, wie es sich im 18. Jahrhundert etwa in den Schriften Rousseaus artikulierte und dann von der Romantik weitergestaltet wurde, zu Anfang nicht unbedingt rein konträr zu den normativen Prinzipien der generalisierenden Moderne verstanden wurde, sondern als deren notwendige Ergänzung und Komplementierung. Autonomie und Authentizität, Freiheit und Schönheit, Gleichheit und Individualität wurden versucht, als Einheit gedacht zu werden; der sich schon damals abzeichnenden Tendenz zu einer „kalten“ – vor allem in den entfremdeten Institutionen der Wissenschaft, der Bürokratie und des Kapitalismus vergegenständlichten – Moderne wurde die kühne Vision einer „warmen“, in Rosas Worten: resonanzsensiblen, Moderne entgegengestellt. Die Moderne zeichnet sich seitdem durch einen Dauerkonflikt zwischen diesen drei Tendenzen – verdinglichender Generalisierung, das Einzelne mystifizierender Reaktion und um Versöhnung bemühter Vermittlung – aus, und das eigentliche Problem unserer Gegenwart wäre demgemäß nicht so sehr der Verlust des Allgemeinen, sondern, genauer gefasst, das Auseinanderklaffen anonymisierender Prozesse wie der Digitalisierung und der gleichzeitigen Tendenz zur (illusionären) Verabsolutierung des Singulären in Bewegungen wie dem Trumpismus, in dem sich nicht von ungefähr äußerster Irrationalismus und technokratische Herrschaftsphantasien wie einst im historischen Faschismus in erschreckender Weise paaren.
Reckwitz gelingt es so auch auf einer rein deskriptiven Ebene nicht, die etwa von Prisching und Schilling betonte Gleichzeitigkeit generalisierender und singularisierender Tendenzen in unserer Gegenwart zu fassen, die genau ihre spezifische Dialektik ausmacht; und er konstruiert eine künstliche Ausweglosigkeit durch das Verschweigen der konkreten historischen Alternative einer vermittelnden Moderne, wie sie insbesondere Kühnlein und Cordemann andeuten. Mehr noch: Insofern er selbst auf dem strikten Dualismus von reiner Wissenschaft und öffentlichem Diskurs, deskriptiver und normativer Perspektive beharrt – Unterscheidungen, die ihrerseits normativ sind –, schlägt er sich unter der Hand selbst auf die Seite der verdinglichenden Moderne, deren Ratlosigkeit ob der irrationalistischen Reaktion er ein weiteres Mal reproduziert.
Der wichtige und konstruktive Beitrag Reckwitz’ zu einer wahrhaft kritischen Theorie der Singularisierung liegt, wie Kühnlein zu Recht hervorhebt, in der demystifizierenden Kraft seiner Theorie. Doch genau dieser Kraft beraubt sie sich, insofern sie ja a priori unterschiedslos jede Form der Singularisierung als Hypostasierung zu durchschauen meint, die Differenzierung zwischen wahrhaften und falschen Formen der Singularisierung überhaupt nicht mehr zulässt und zwischen terroristischem Sendungsbewusstsein und befreienden Praktiken der individuellen Emanzipation keinen Unterschied mehr zu machen weiß.
Alternative soziologische Ansätze wie der zeitgenössische von Rosa oder auch die Theorien Charles Taylors, Anthony Giddens und Fredric Jamesons, die schon in den 80ern teilweise sehr ähnliche Zeitdiagnosen artikulierten wie Reckwitz, zeichnet demgegenüber ein größeres nicht nur normatives, sondern auch deskriptives Potential aus; nur eine normativ gesättigte Beschreibung ermöglicht eine adäquate Darstellung der Gesellschaft und umgekehrt.
Der Vorwurf der mangelnden Originalität gegenüber Reckwitz liegt nahe, und man mag unken, dass er das Spiel der Aufmerksamkeitsökonomie und der Inszenierung von Neuheit, das er so detailliert beschreibt, selbst sehr gut beherrscht. Man könnte ihm sogar vorhalten, ursprünglich kritisch intendierte Konzepte aufzugreifen, ihnen ihre normative Spitze zu nehmen und genau dadurch für den desillusionierten Mainstream erträglich zu machen, der gegenüber der Illusion schon längst kapituliert hat. Anzuwenden wäre das Konzept der Singularisierung nicht zuletzt auf den Wissenschaftsbetrieb selbst, der mehr und mehr den Hype um immer wieder neue Modetheorien durch die redliche Reflexion ersetzt, in der idealerweise individuelle Erfahrung und reflexiver Blick in letzter Instanz zusammenfallen.
Am Schluss seines Beitrags macht demgegenüber Priddat einen bemerkenswert einfachen Vorschlag, wie man echte und wahrhafte Neuheit unterscheiden könnte: „[I]ndem wir neue Welten probieren, verlassen wir unsere konventionellen Pfade. Wir öffnen unsere Identitäten, über marginale Differenzen hinaus. Wir beginnen, uns zu transformieren. Die wirklichen neuen Dinge sind jene, die uns transformieren“ (176 f.).
Eine solche Erfahrung bleibt bei der Beschäftigung mit Reckwitz’ Theorie leider weitgehend aus. Mich lässt sie jedenfalls eher kalt zurück. Sie wirft zweifellos die richtigen Fragen auf, doch verunmöglicht zugleich die Perspektive auf eine Antwort. Sie reformuliert weitgehend bereits Gesagtes, und das auch noch in depotenzierter Form, und entspricht allzu sehr dem, was man ohnehin schon weiß und redet. Von einem wirklich großen Wurf würde man sich mehr erwarten – doch vielleicht hat das schlechte Auseinanderdriften von Generalisierung und Singularisierung die Wissenschaft auch schon zu sehr erfasst, um ihn noch leisten zu können.