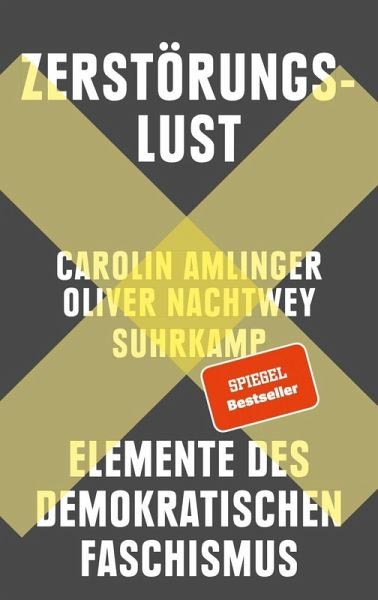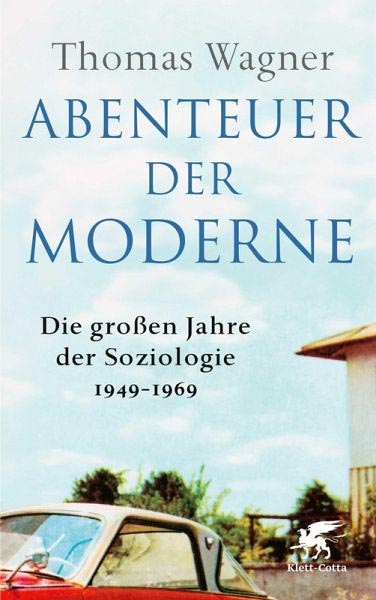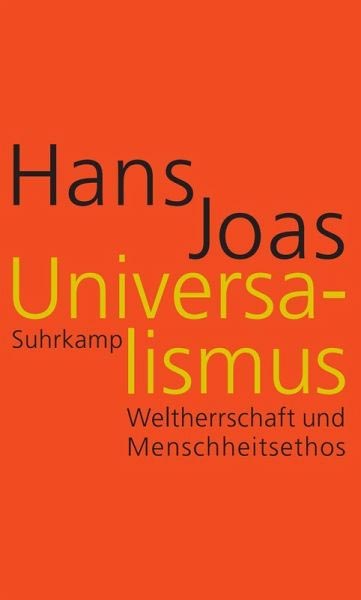Carolin Amlinger, Oliver Nachtwey
Zerstörungslust
Elemente des demokratischen Faschismus
geb., 453 Seiten, 30,- €
Berlin 2025, Suhrkamp-Verlag
von Bernhard Schindlbeck
Dass die liberale Demokratie durch rechtspopulistische Bewegungen, Parteien, Akteure und Regierungen in Bedrängnis und unter Druck, ja in Existenznot geraten ist, wird so massenhaft wie hilflos beklagt, aber kaum jemand fragt, weshalb das so ist. Endlich, so muss man deshalb wohl sagen, erforscht jemand systematisch, vielschichtig und mit Genauigkeit die mannigfaltigen Ursachen dieser Misere. Und am liebsten würde man das Buch allen Abgeordneten und Regierungsamtsinhabern zur Pflichtlektüre machen. Zum Beispiel stehen alle Innenminister immer hilflos vor dem auf sie wie ein unlösbares Rätsel wirkenden Phänomen und finden keine Erklärung, weshalb Menschen Feuerwehrleute und Rettungssanitäter bei ihrer Arbeit behindern und sogar angreifen. Auf den Seiten 123 und 124 könnten sie sich einschlägig informieren und dann sogar, falls sie es schaffen, über ihren ideologischen Schatten zu springen, etwas begreifen. Warum, so fragen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey in ihrem mit dem Geschwister-Scholl-Preis 2025 ausgezeichneten Buch, „hat in liberalen Gesellschaften eine nicht unerhebliche Zahl an Menschen eine Gefühlsstruktur angenommen, die sich in Abwehr und Destruktion äußert?“ (112) Und sie erklären: „Unser Buch ist weniger eine Bestandsaufnahme neufaschistischer Projekte als vielmehr eine Suche nach den Gründen, warum sie auf so viel Zustimmung stoßen“ (13). Indirekt und unbeabsichtigt zeigt das Buch also auch, dass viele Politiker die Gesellschaft, in der sie agieren, gar nicht verstehen, weshalb ihr Handeln nicht in der Lage ist, den neofaschistischen Tendenzen etwas entgegenzusetzen.
In gewisser Weise schließen die Autoren an ihr Buch Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus von 2022 an. In zweifacher Hinsicht steht es in der Tradition der klassischen kritischen Theorie. Zum einen orientiert es sich methodisch (in modifizierter Weise) an den Untersuchungen des Instituts für Sozialforschung zur autoritären Persönlichkeit, außerdem will es ausdrücklich als wissenschaftliche Publikation politisch wirksam sein: „Adorno schrieb 1950, ‚die Wissenschaft‘ müsse ‚Waffen gegen die potentielle Drohung der faschistischen Mentalität‘ finden. Hierzu soll dieses Buch einen Beitrag leisten“ (26).
Die Intention und das Erkenntnisinteresse sind klar: „Uns geht es vor allem darum, die Wechselwirkungen zwischen sozioökonomischen sowie politischen Veränderungen und Gefühlsstrukturen zu analysieren. Wir orientieren uns dabei zwar stark an den Autoritarismus-Theorien der Frankfurter Schule, machen uns aber die in den Studien zum autoritären Charakter hinterlegte individualpsychologische Perspektive nur eingeschränkt zu eigen. Destruktivität begreifen wir nicht als einen in die Persönlichkeit eingelassenen Charakterzug, sondern wir betrachten sie als etwas Dynamisches … Wie lässt sich erklären, dass viele Menschen – wenn auch nicht die Mehrheit – autoritäre und destruktive Einstellungen entwickelt haben, obwohl sie keine autoritäre Grunddisposition haben, obwohl sie als Kinder viel weniger streng erzogen wurden, obwohl Männer nicht mehr zum Militärdienst müssen, beide Geschlechter mit anderen Rollenvorstellungen in Berührung kommen und in zunehmend liberalen Gesellschaften aufgewachsen sind?“ (25 f.)
Die empirische Grundlage der Studien bilden eine Umfrage mit 2060 Personen und ausführliche Gespräche mit daraus ausgewählten 41 Interviewpartnern, nämlich AfD-Wählern oder Sympathisanten; Ausschnitte aus diesen Gesprächen oder Zusammenfassungen werden über das Buch verstreut eingebaut, um die theoretischen Erkenntnisse zu illustrieren. Da die westliche Gesellschaft am Beispiel von USA und Deutschland in den Blick genommen wird, kommen (neben anderen europäischen Parteien und Politikern) in der Konkretion vorwiegend die neofaschistischen Kommunikations- und Politikstile Trumps und der AfD vor.
Der Ausdruck „demokratischer Faschismus“ scheint ein Oxymoron, auf den ersten Blick ein Widerspruch in sich selbst zu sein. Allerdings wird in der Abgrenzung der gegenwärtigen Phänomene vom „historischen Faschismus, der die Demokratie offen bekämpfte“ deutlich, inwiefern der demokratische Faschismus „in der Demokratie verankert“ ist und „sich als ihr Erneuerer“ versteht. „Gleichzeitig untergräbt er ihre Grundlagen. Treibende Kraft ist die Zerstörungslust. Mit seiner lustvollen Grausamkeit sowie dem frivolen Spiel der Gewalt geht der demokratische Faschismus über den Rechtspopulismus hinaus“ (12). Die destruktiven Impulse dieser neuen Art des Faschismus richten sich grundsätzlich gegen alles Liberale, Fortschrittliche und Emanzipatorische der liberalen Demokratie. Ausführlich erklären die Autoren: „Wir wählen für unsere Analyse eine Perspektive, in der wir die grundsätzliche Problemkonstellation des historischen Faschismus aufnehmen, dabei jedoch die veränderten Strukturen, Normen und Handlungskonstellationen in der Gegenwart berücksichtigen. Auf der makrosoziologischen Ebene lässt sich dabei zunächst feststellen: Der Faschismus resultiert auch heute – nicht nur, aber wesentlich – aus Krisen der kapitalistischen Moderne, in der sozioökonomische und moralische Fortschritte blockiert sind. Dennoch unterscheiden sich die Zeit der Großen Depression und unsere Gegenwart signifikant: Mit der Massenarbeitslosigkeit der Jahre 1929ff. wurden große Teile der Mittelklasse pauperisiert. Sie büßten ihren Status ein und hofften, ihn durch eine Zerstörung der sozialistischen Arbeiterbewegung zu restaurieren. Heute hingegen sind eher die Angst vor Statusverlust, eine gefühlte Blockade und das Nullsummendenken die Quelle faschistischer Affekte“ (258 f.).
Das Nullsummendenken „ist eine zentrale, wenn nicht die wesentliche mentale Schaltstelle, um die Entstehung des gegenwärtigen Faschismus zu verstehen“ (50). Es ist eine Folge davon, dass ohne entsprechende Wachstumsraten viele Menschen das Gefühl haben, es sei nicht genug für alle da, sodass das, was der eine bekommt, dem anderen vorenthalten wird. Alles, was Flüchtlingen, Fremden, Migranten zugutekommt, fehlt den einheimischen Deutschen. Dieses simple Denkmuster kommt dadurch zustande, dass – wie in den ersten beiden Kapiteln (Nach dem Fortschritt und Blockiertes Leben) detailliert herausgearbeitet wird – Demokratie und Liberalismus nicht mehr in der Lage sind, die Versprechen, die mit ihnen gemeinhin verbunden werden, einzulösen, vor allem die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs („die Kinder werden es einmal besser haben“) und der materiellen Verbesserung der eigenen Lage. Der Liberalismus hat seine Kraft und Glaubwürdigkeit verloren, er „leidet unter einem Mangel an Problemlösungskapazitäten“ (15), wie allabendlich in den Fernsehnachrichten und in den Talkshows ausführlich gezeigt wird. Im Rückgriff auf die Untersuchungen von Karl Polanyi und Seymour Martin Lipset über die sozioökonomischen Grundlagen des Funktionierens der Demokratie zeigen Amlinger und Nachtwey, woran genau die Demokratie heute scheitert. Die Wachstumsraten von 1961 bis 2023 für USA und Deutschland zeigen, wie es dem Kapitalismus immer weniger gelingt, ein hinreichendes Wachstum zu generieren, um Wohlstand auch für die mittleren und unteren Schichten zu garantieren und den Wohlfahrtsstaat zu finanzieren. Politik ist nicht in der Lage, Lösungen für die vielen Krisen (Klimawandel, Wachstumskrise, Renten- und Pflegeproblematik, marode Infrastruktur, Finanzierung des Gesundheitssystems, des Bildungssystems usw.) zu entwickeln. Der Neoliberalismus hat, gerade unter sozialdemokratischen Regierungen (Clinton, Blair, Schröder), neue eklatante Ungleichheiten geschaffen und zur Eskalation dieser Ungleichheit beigetragen, wobei im selben Zug soziale und demokratische Rechte und Institutionen, die einst für die Einhegung des Kapitalismus sorgten, in vielen Bereichen abgewickelt wurden. Die moderne Gesellschaft wird regressiv, was sich vor allem für die Unterklassen negativ auswirkt. „Die Politik ist nicht länger in der Lage, effektiv für Wachstum und Aufwärtsmobilität zu sorgen, wodurch sie in den Augen vieler Bürger:innen an Legitimation einbüßt. Zugleich lässt der beschleunigte soziale Wandel neue Spaltungslinien aufbrechen. Bislang nicht repräsentierte Gruppen werden besser integriert; zuvor privilegierte Gruppen fühlen sich übergangen und von einer ‚woken‘ Hegemonie bedroht. Diese gefühlte Bedrohung ist eine wichtige Quelle des gegenmodernen Projekts“ (47 f.).
Für immer mehr Menschen ergibt sich angesichts der nicht endenden Sparpolitik aller Regierungen der Eindruck, das eigene Leben sei blockiert, ein Gefühl der Perspektivlosigkeit und der Ohnmacht, das anfällig für Autoritarismus macht. Bei der Erklärung des „Gefühl[s] des blockierten Lebens“ beziehen sich die Autoren umfassend auf Studien Erich Fromms, der in seinem Buch Die Furcht vor der Freiheit (1941) von der „Vereitelung des Lebens“ sprach. „Die Räder des gesellschaftlichen Antriebsmechanismus bewegen sich nicht mehr synchron, sie erzeugen eine Blockade. Dies drückt sich in empfundenen Benachteiligungen aus, etwa dem Gefühl, sich hinten anstellen zu müssen, nicht auf seine Kosten zu kommen, den Kürzeren zu ziehen. Die moderne Idee gelungener Lebensführung, die auf Maximen des quantitativen Zuwachses und der qualitativen Verbesserung gründet, stößt im Gefühlshaushalt der Nachmoderne auf Schranken. Potenzialitäten, die nicht verwirklicht werden können, werden zu verhinderten Möglichkeiten“ (134). Klar ist, dass es hier nicht um einzelne enttäuschte Wünsche geht, sondern um „eine umfassende Blockade.“ Das Leben ist für Fromm „durch eine expansive Dynamik geprägt: Menschen wollen sich ausbreiten und Spuren in der Welt hinterlassen. Werde ‚diese Tendenz vereitelt‘, so Fromm, … scheine ‚die auf das Lebens ausgerichtete Energie einen Zerfallsprozeß durchzumachen und sich in Energie zu verwandeln, die auf Zerstörung ausgerichtet ist. … Destruktivität ist das Ergebnis ungelebten Lebens.‘ Diese Beobachtung ist so hellsichtig wie folgenreich. Sie führt uns zum Kern der gegenwärtigen Zerstörungslust“ (135).
Das dritte Kapitel untersucht verschiedene Grade, Typen und Formen der Destruktivität, ordnet sie statistisch bestimmten Einstellungen (etwa Antisemitismus, Anti-Gender, Klimaskepsis und Formen des Autoritarismus wie Unterwürfigkeit, Aggression und Konventionalismus), aber auch sozialen Schichten und Berufsklassen nach AfD-Wahlabsicht zu. Als die drei grundlegenden Typen der Destruktivität werden sog. Erneuerer, Zerstörer und Libertäre ausgemacht. Die Erneuerer wollen die liberalen Institutionen „erschüttern, um auf ihren Trümmern eine Gesellschaft mit traditionellen Hierarchien wieder- oder neu aufzubauen und sie schließlich saniert in die Zukunft zu führen“ (214). Die Gesellschaft der Vergangenheit mit tradierten Rollenbildern und ohne (bzw. mit nur geringer) Migration imaginieren sie als „Normalität“. Dagegen weisen die Zerstörer „viele Züge der von Fromm identifizierten rachsüchtigen Destruktivität auf, die ‚oft grausam, lustbetont und unersättlich‘ sei. Es gibt unter den Zerstörern mitunter eine regelrechte Strafsucht, auch die Todesstrafe wird von ihnen häufig befürwortet und gilt als probate Lösung sozialer Probleme. Zugleich fürchten sie sich besonders vor Heterogenität, Diversität und gemischten Verhältnissen jeder Art (der Geschlechter, der Hautfarben, in der Gesellschaft usw.), wobei sie diese Angst oft mit biologischen und evolutionstheoretischen Argumenten unterlegen“ (215). Die libertären Autoritäten vertreten einen radikalen Individualismus, eine ausgeprägte Migrationsfeindlichkeit und „wollen sich nicht zuletzt aus ideologischen Gründen des regulierenden Staates entledigen“ (217). Eine Geneinsamkeit aller Typen besteht darin, dass in all ihren Ansätzen zur Kritik der demokratischen Gesellschaft der Kapitalismus ausgespart bleibt.
Das vierte Kapitel (Demokratischer Faschismus) widmet sich ausführlich dem Begriff des Faschismus, der bekanntlich oft sehr leichtfertig und vorschnell bestimmten politischen Erscheinungen als Etikett angeheftet wird. Zunächst wird die „Bivalenz des Faschismus“ (237 ff.) als Grundmuster erläutert, womit der „Doppelsinn oder die Doppelbödigkeit von Sprechakten oder symbolischen Handlungen, die neben der wörtlichen noch eine weitere Bedeutung transportieren“, gemeint ist (239 f.). Mussolini ist ein perfektes Beispiel für solche Sprechakte, die durch ihre Bivalenz Wahrheitsansprüche und Zurechenbarkeit sowie Verantwortung immer unterlaufen und eine Atmosphäre schaffen, „die sich hinter dem Gesagten verbirgt. Faschistische Dispositionen zeigten sich in unseren Gesprächen oft in Allegorien oder vagen Andeutungen. Im Zweifel können die Interviewten immer behaupten, es sei eigentlich ganz anders gemeint gewesen.“ Der Faschismus befördert etwas, „das in einem vagen Gefühl bereits vorhanden ist, aber unbestimmt bleiben soll. Faschistische Politik ist eine Führung der Gefühle, in der unbewusste Impulse, Wünsche und Ängste nicht bewusst gemacht, sondern ‚künstlich unbewusst‘ (Adorno) gehalten werden“ (241). Dass sich dafür auch Mythen des Nationalen und Schicksalhaften perfekt eignen, leuchtet ein. „Es sind Erzählungen ewiger Wiederkehr und schicksalhafter Fügung, die die Prüfungen des Lebens mit Bedeutung ausstatten und Menschen ihren Platz in einer überzeitlichen Ordnung zuweisen, wenn die eigene Existenz als kontingent und der eigene Lebenslauf als blockiert wahrgenommen wird. Wer den Mythos – vor allem jenen der historischen Mission der eigenen Nation – erkannt hat und an ihn glaubt, kann sich erhaben fühlen … Auf dem Mythos gründet der affektive Magnetismus des Faschismus, da er ein Gefühl des Ungenügens und des Mangels in Größe umwandelt“ (242).
Um die vielfältigen Facetten des „demokratischen Faschismus“ richtig einzuordnen, werden im Rückgriff auf den historischen Faschismus verschiedene Definitionen und Erklärungen des Faschismus – von Georgi Dimitroff bis Robert Paxton, Michael Mann, Roger Griffin usw. – kontrastierend betrachtet und geprüft. Zentrale Elemente sind immer wieder die Sakralisierung der Nation, die Gewaltverherrlichung und der antimoderne Impuls. Die Autoren verflechten ihre Ergebnisse mit einem umfangreichen kulturellen Wissen innerhalb eines weiten Horizonts nicht nur profunder soziologischer, politikwissenschaftlicher und historischer Kenntnisse, auch psychoanalytische Befunde (etwa aus Theweleits Männerphantasien) und Überlegungen postmoderner Autoren wie Foucault, Deleuze und Guattari (Anti-Ödipus und Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie) oder Lacan (Encore. Das Seminar) werden in die Erklärungen unterstützend einbezogen. Im Schlusskapitel (Ein neuer Antifaschismus) wird deutlich ausgesprochen, dass ein neuer Antifaschismus notwendig ist und dieser logischerweise nicht aus dem Liberalismus kommen kann, da letzterer mit seinem Versagen als Mitverursacher an der Wiege des neuen demokratischen Faschismus steht. Schon Polanyi kam ja zu der Schlussfolgerung, dass die liberale Marktgesellschaft eine für die menschliche Gemeinschaft zerstörende Wirkung hat. Deshalb schließt das Buch mit einem leicht abgewandelten Zitat von Max Horkheimer: „Wir sind so frei, abschließend ein bekanntes Diktum Max Horkheimers ein wenig zu ergänzen: Wer aber vom Kapitalismus und vom Liberalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen“ (321). Dass diese Ergänzung notwendig ist, erschließt sich schon aus der Tatsache, dass der Liberalismus bei all seinen theoretischen Auffächerungen und unterschiedlichen Akzentuierungen letztlich immer nur ein ideologischer Appendix des Kapitalismus war.
Amlinger und Nachtwey legen hier ein überaus wichtiges und lesenswertes Buch vor, das in vielen Richtungen und Verästelungen einem neuen Phänomen nachgeht, das bislang mit dem Ausdruck Rechtspopulismus eine eher verharmlosende Bezeichnung erhalten hat, weshalb der Untertitel vollkommen berechtigt ist. Seine Befunde werden auch durch andere Studien bestätigt. So kommt zum Beispiel eine Allensbach-Umfrage vom November 2025 zu dem Ergebnis: „Das Vertrauen in demokratische Systeme schwindet. Viele Deutsche trauen mittlerweile autoritären Systemen mehr Krisenkompetenz zu als Demokratien“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.11.2025).
Es bleibt nur die Frage, ob etwas nicht oder nicht ausreichend beleuchtet ist. Denn es fällt ja auf, dass die Grobunterscheidung zwischen Demokraten einerseits und Anhängern des neuen Faschismus andererseits von den Autoren beibehalten wird. Für Deutschland heißt das: Hier die sog. demokratischen Parteien, dort die AfD und ihre Wähler und Anhänger. Dass es jedoch dazwischen eine Zone des Übergangs und eben keine Kluft gibt, wird nicht deutlich genug. Im Spiegel-Interview etwa sagt Carolin Amlinger: „Selbst wer kein großer Anhänger des aktuellen CDU-Fraktionsvorsitzenden ist, wird ihm richtigerweise kaum absprechen, ein Demokrat zu sein. Bei den konservativen und nationalen Kräften in der Weimarer Republik war das anders“ (42/2025). Mit solchen wohlmeinenden Zuschreibungen übersieht man aber, dass faschistoide Einstellungen immer wieder gerade von Politikern und Journalisten bedient werden müssen, was in der Ära der Sozialen Medien natürlich einfach ist. Jedoch auch etablierte Publikationen wie Cicero, Bild und Welt, Plattformen wie Die Achse des Guten unterstützen neben konservativen Politikern aus der vermeintlichen Mitte und anderen sog. Experten ganz kräftig die Haltungen des demokratischen Faschismus. Ausgerechnet Jens Spahn hat in der Causa Brosius-Gersdorf gezeigt, wie wenig abgeneigt er der Disruption von hergebrachten Spielregeln im parlamentarischen Procedere ist, wie sehr der breite rechte Rand der Mitte sich vom Mob anstacheln lässt. Und wenn etwa ein Ministerpräsident Söder verkündet: „Es kann nicht sein, dass jemand, der bei uns ist, quasi eine Art Asylgehalt bekommt und davon dann noch perfekt leben und die gesamte Heimat finanzieren kann,“ dann reiht er sich damit in die Unterstützer des demokratischen Faschismus ein. Ebenso Friedrich Merz im September 2023 mit seiner Aussage von den dreihunderttausend abgelehnten Asylbewerbern, die „die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.“ Damit fördert er mit voller Absicht das von Amlinger und Nachtwey analysierte Nullsummendenken und die Haltung „Ich muss verzichten, weil Migranten illegitimer Weise etwas bekommen, was eigentlich mir zusteht“. Desgleichen ist seine Aussage zum Stadtbild im Zusammenhang mit Migration („Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.“) ein Musterbeispiel für bivalent faschistische Aussagen. Hinterher kann man (so wie Merz es macht) „immer behaupten, es sei eigentlich ganz anders gemeint gewesen“ (241). Und auf die Rückfrage, wie er es denn gemeint habe, kommt ein charakteristisch ungenaues und vages „Fragen Sie ihre Töchter“. Das ist der im Buch beschriebene kommunikative Stil des Faschismus. Man muss die Demokratie also auch gegen solche Unterstützer des Mobs aus der konservativen Mitte heraus verteidigen. Und dabei müsste man den Mut haben, sie namentlich zu nennen, denn sonst lässt sich die Demokratie nicht verteidigen. Dieser Mut hätte dem Buch gut getan.