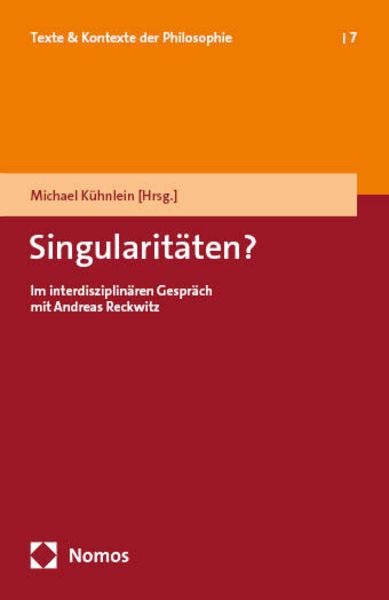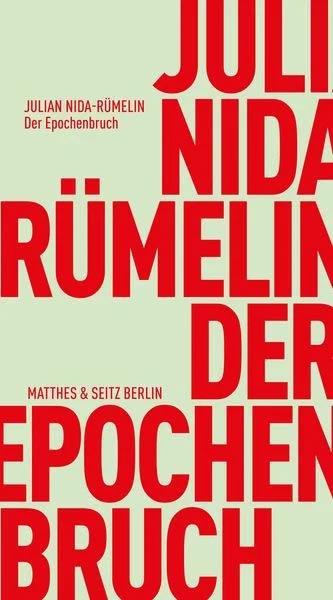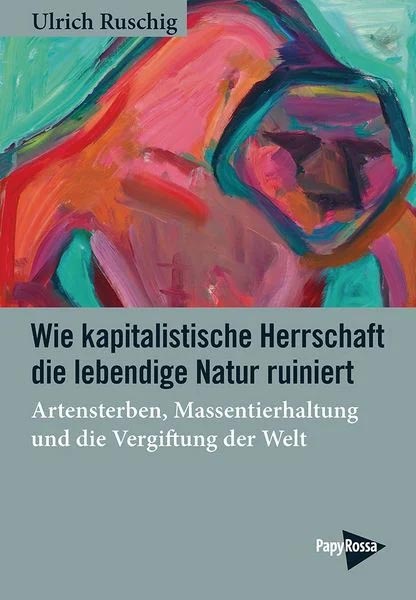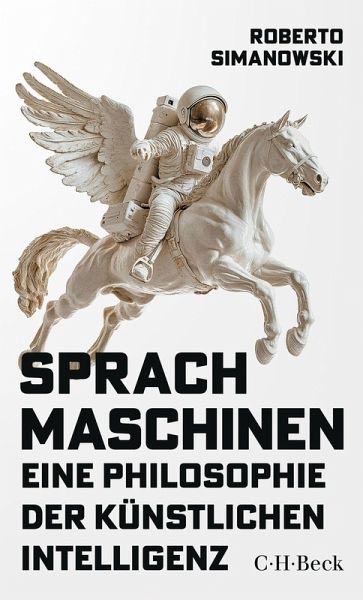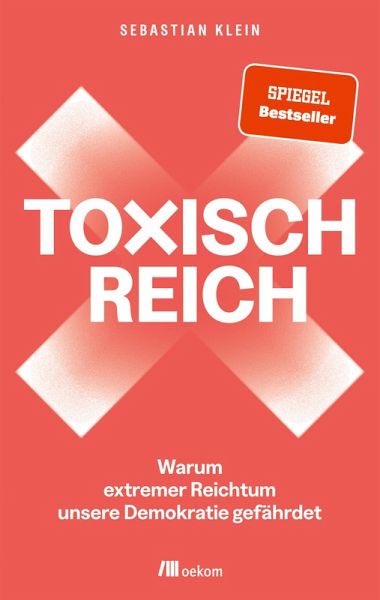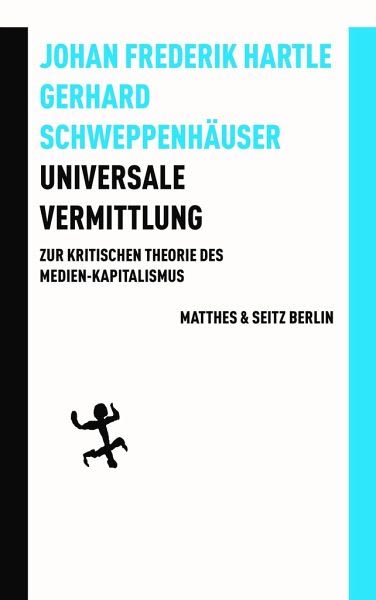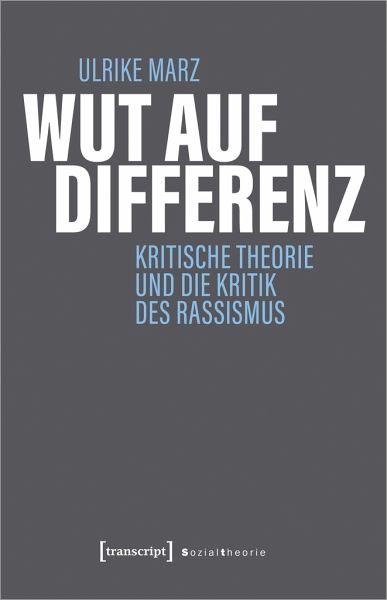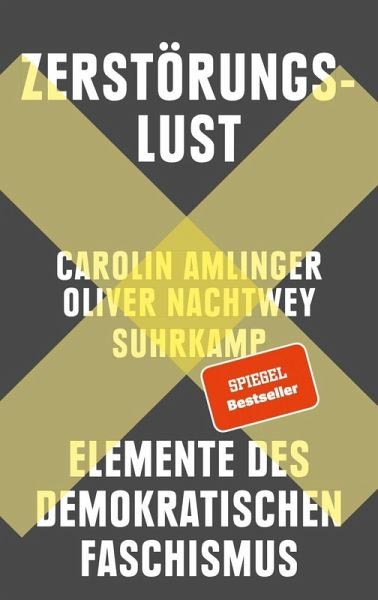Christine Steffen (CS): Heide, du bist einer breiteren Öffentlichkeit, vor allem in der Frauenbewegung, durch deine beiden Bücher „Die tanzende Göttin“ und „Die Göttin und ihr Heros“ zur Matriarchatsforschung bekannt geworden. Wie und wann begann das?
Heide Göttner-Abendroth (HG): Zu deiner ersten Frage: Als ich vor ca. 20 Jahren auf diesem Gebiet zu forschen anfing, waren die Begriffe wie „Patriarchat“ und „Matriarchat“ noch völlig tabu; da gab es die Neue Frauenbewegung ja noch gar nicht, und ich habe meine Arbeit ganz alleine machen müssen. Ich habe mich niemandem zu sagen getraut, was ich forsche. Wenn ich jemandem gesagt hätte, das und das sei patriarchal, hätte man nur gelacht. Oder, wenn ich behauptet hätte, ich beschäftige mich mit Matriarchaten, dann hätte man mich für blöd erklärt. Also, ich sage es jetzt etwas grob: Ich habe schön mein reguläres Philosophiestudium gemacht, und diese „unseriöse Forschung“ in den Semesterferien und habe niemandem etwas davon mitgeteilt. So war das geistige Klima, bis dann durch die Frauenbewegung solche Begriffe wieder salonfähig und nachdenkenswert wurden. Das hat zehn Jahre gedauert; zehn Jahre Kritik auch von der Frauenbewegung her, die diese Begriffe zuerst wieder in den Mund genommen hat.
Heute arbeite ich zugleich theoretisch und praktisch. Theoretisch versuche ich, das, was die patriarchale Gesellschaftsform ausmacht, zu erkennen und zu kritisieren. In erster Linie bin ich mit der Erforschung der Geschichte und Gesellschaftsform des Matriarchats beschäftigt. Mir liegt daran, diese Gesellschaftsform in ihrer Vielschichtigkeit und ihrer langen Geschichte zu erforschen; denn in der Forschung sind wir heute noch ziemlich am Anfang. Seit Bachofen ist zwar viel herumgeforscht worden, aber ich kann wirklich sagen, nur herumgeforscht; denn das war ein Thema für Ideologien, Selbstrechtfertigungen und Weltbildforscherei am laufenden Band. Bisher ist das – ich kenne die ganze Forschungsliteratur – nicht einmal halbwegs neutral und sachgerecht abgehandelt worden. Das ist bei mir das erste sachliche und wissenschaftliche Interesse. Zur Zeit sitze ich an einem größeren Werk zur Geschichte der Gesellschaftsform des Matriarchats. Was in den beiden Büchern steht, die ihr kennt, sind nur kleine Ausschnitte aus meiner Forschung, die ich mittlerweile schon länger mache, durch die ich meine Interessengebiete wie die Mythologie, die Kunst und die Ästhetik bestimmt habe.
Matriarchatsforschung und Frauen-Gruppenarbeit
Alexander von Pechmann (AvP):Wie du schon angedeutet hast, ist für dich die Matriarchatsforschung ja kein Selbstzweck, sondern die Folge deiner Kritik des Patriarchats. Wie ist deine Haltung dazu? Lehnst du patriarchale Gesellschaftsformen generell ab, oder siehst du in ihnen auch kulturhistorisch wertvolle Teile und Errungenschaften, die erhaltenswert sind?
HG: Ehe wir eine zureichende Kritik des Patriarchats machen können, müssen wir überhaupt erst mal in Einzelheiten wissen, was die matriarchale Gesellschaftsform in ihrer Gesinnung, in ihrer Sozialstruktur und ihrer Ökonomie ausgemacht hat. Das ist ja, wie gesagt, höchst unzureichend erforscht. Erst wenn wir das wissen, finden wir die historische Folie, um uns klar zu werden, was im Patriarchat absorbiert, verändert oder auch weiter entwickelt worden ist. Mich interessiert in meiner Forschung ja nicht nur die Zeit der matriarchalen Gesellschaftsform, sondern genauso, wie in patriarchalen Gesellschaften matriarchale Traditionen weitergewirkt haben. Wie haben sie dort, auch untergründig, gearbeitet? Wie sind sie aufgenommen worden und haben dann wiederum Verbesserungen im Gesellschaftsablauf gebracht? Das ist eine Aufgabe, an der ich bestimmt noch zwei Jahre arbeite. Dann können wir zu einer vernünftigen und ruhigen, kritischen Einschätzung des Patriarchats kommen.
In den Büchern, die ihr kennt, vor allem die „Tanzende Göttin“ als einem rein essayistischen Buch, musste ich vieles plakativ in Antiposition darstellen, was bei einer genaueren gründlichen Erforschung so nicht stehenbleiben kann. Es gibt in patriarchalen Gesellschaften auch Entwicklungen, die stärkere Ausdifferenzierung von Arbeitsbereichen und Produktivkräften, gewisse Rationalisierungen von Wissenschaft und Technik, die durchaus nützlich und fruchtbar sind. Die Frage ist nicht: Wie kann man das in Bausch und Bogen heute abschaffen und zur Jungsteinzeit zurückkehren? Das wäre sehr naiv und romantisch. Die Frage ist: Von welcher Werthaltung aus sind diese patriarchalen Gesellschaften kreiert und angewandt worden? Das ist das, was wir kritisieren müssen. Nicht, dass das erfunden worden ist, sondern die Werthaltungen, die oft höchst menschenfeindlich sind, aus bestimmten Zwängen oder Wünschen zur Herrschaft und Herrschaftsausübung, die die patriarchale Geschichte durchziehen.
Ich möchte auch am Ende meiner Forschungen versuchen, eine matriarchale Utopie auf einer neuen philosophischen Ebene entwickeln. Und da ist es natürlich wichtig, wie wir heute die Errungenschaften, die aus der patriarchalen Zivilisation stammen, in eine neue Werthaltung integrieren können. Und diese neue Werthaltung knüpft, in gewisser Weise, an Bewusstseinsformen an, die in diesen alten Matriarchaten geherrscht haben, die nicht hierarchisch waren, auch nicht herrschaftsdurchsetzt, sondern die dem Menschen gegenüber weitaus humaner zugewandt waren als patriarchale Gesellschaften mit ihren Herrschafts- und Rechtszwängen. Was mich eben in meiner Forschung wirklich interessiert, ist, wie sich die reichen wissenschaftlichen Erkenntnisse und technischen Errungenschaften integrieren lassen in ein ganz neues Verhältnis gegenüber dem Menschen, der Gesellschaft und der Natur. Ich glaube, das ist etwas, das uns alle drängt, was wir alle irgendwo suchen.
Gerlinde Schermer (GS): Du willst also eine Veränderung hin zu einer humaneren Gesellschaftsform. Bei dem Wie? würde mich interessieren: Wie groß ist das Interesse von Frauen? Was für Auswirkungen hat das? Verstehst du darunter eine einfache Vervielfältigung durch Gespräche? Wie soll man sich das auch sinnlich aneignen?
HG: Weißt du, ich kann da nur kurz auf meine vielfältige Arbeit verweisen. Ich arbeite theoretisch durch Bücher, Vorträge und Seminare. Da erreiche ich relativ viele Menschen, Frauen und Männer. Nur ist die Ebene, auf der ich sie erreichen kann, wiederum die der Argumente und des Intellekts. Das ist zwar ein wichtiger erster Zugang. Aber deine Psyche einmal auszuprobieren, dazu kommen wir damit nicht. Das ist eine Arbeit, die ich nur intensiv mit Gruppen machen kann. Es ist zwar viel, theoretisch so zusammenzuarbeiten; aber ich möchte diese beiden Arbeitsformen integrieren und neue Formen der Lehre finden. Ich bin etwas frustriert von diesen Lehrformen an der Universität, die ich lange gemacht habe, und auch von der Vortragsform, die ich jetzt noch machen muss. Da stehe ich vorne und rede, die Zuhörerinnen sitzen und hören zu, und dann kommt es bestenfalls noch zu einer Diskussion. Andere Vermittlungsformen zeigen sich mir ja schon in den engeren Gruppen, aber da habe ich mit meiner Erfahrung eben erst begonnen.
Es gibt auch ein ganz simples Problem: Nach zwei Jahren praktischer Arbeit ist der Zulauf ziemlich groß. Ich bereite gerade unser großes Winterabschlussfest vor; eine große Veranstaltung, an der viele Frauen teilnehmen können, und die ihnen unsere Arbeit einmal in einem großen Fest zeigt. Ich muss sagen, das Interesse ist ungeheuer groß, weil die Frauen genau spüren, dass diese Art der Arbeit zugleich intellektuell, künstlerisch und seelisch ist, und, was einen wohltuenden Effekt auf uns alle hat, ganzheitlich zusammenkommt. Das spricht sich zur Zeit ziemlich herum.
GS: Ich frage mich, ob es wirklich so viele Frauen gibt, die bereit sind, sich ein ganzes Jahr darauf einzulassen und dazu auch die Möglichkeiten haben.
HG: Über das ganze Jahr sind es wenige. Die Gruppen sind nie größer als 12 bis 14 Frauen. Aber bei diesem großen Fest kommen auch viele Frauen, die das einfach mal sehen wollen.
CS: Ich habe deine Frage so verstanden, Gerlinde, dass du meinst, inwieweit diese Frauen auch als Multiplikatorinnen wirken.
HG: Das kann werden. Ich wünsche mir das natürlich auch, aber ich kann das weder planen noch bestimmen. Das hängt sehr von den Vertiefungsprozessen ab, die jede Frau machen muss. Ich habe vor, nach dem dritten oder vierten Jahr diese Arbeit auf verschiedene Weise zu dokumentieren: durch Filme und ein Buch, vielleicht auch durch Ausstellungen. Das sind dann allerdings nur Dokumente. Da treten künstlerische Formen auf wie Hüllen dieses Prozesses; denn im Grunde zeigt eine Ausstellung und auch ein Film nicht das Fest, sondern nur die Hülle davon. Ich glaube, da tritt die Kunst tatsächlich in das ein, was ich als die ‚quasi-patriarchale Kunst‘ beschreibe. Ich benütze sie bewusst als Hüllen, die aber denen, die interessiert sind, vielleicht einen Eindruck davon geben, wie vielfältig und auf welchen Wegen das abläuft. Das kann eine Entscheidungshilfe sein, darin mitzuarbeiten; aber der Prozess ist es nicht. Wenn ihr ein Kunstprodukt eines Künstlers vor euch habt, ein Bild, dann ist das bloß die Hülle seines inneren Prozesses.
Kunst als Fiktion?
Ulrike Schwemmer (US): Du sagst, dass alle traditionelle Kunst reine Fiktion sei. Wenn du jetzt aber ein Bild als Hülle eines ganz bestimmten Prozesses und sie als Fiktion beschreibst, wie grenzt du dann die matriarchale Kunst davon ab?
HG: Die matriarchale Kunst, das sind diese Feste. Die kommen und vergehen, du kannst sie nicht sehen, sondern wirklich nur drin leben. Was ich dann davon dokumentieren kann, wie einen Film oder eine Ausstellung, das sind die Hüllen. Da gehe ich quasi in den patriarchalen Kunstbetrieb und benütze dessen Hüllencharakter.
US: Dann wäre das aber auch Fiktion, in deinen Begriffen.
HG: Es ist insofern eine Fiktion, weil es nicht mehr der seelische oder der spirituelle Prozess ist, nur noch die Abbildung davon.
US: Wenn du sagst, die patriarchale Kunst sei rein fiktional, – meinst du damit nur, dass du nur das Endresultat eines Prozesses hast, das sich abgelöst hat?
HG: Genau das. Die Kunst besteht aus Objekten, und die Objekte sind tatsächlich ein Endprodukt, ein Ding, das sich verfestigt hat aus dem seelischen Prozess des Künstlers. Nur so, als Ding oder als Ware, wird sie dann verfügbar auf dem patriarchalen Kunstmarkt; denn die Prozesse selbst sind nicht verfügbar. Insofern sage ich auch immer zu meinen Frauen, nachdem ein Jahr um ist: jetzt habt ihr ein wunderbares Kunstwerk erlebt; und es kam und es ging.
GS: Wenn ich dich recht verstanden habe, dann wendest du dich auch sehr gegen die Normensetzungen einer patriarchalen Ästhetik, die die künstlerische Aktivität einschränken würde. Ich bin jetzt doch etwas verwundert, weil der Jahreszeitenzyklus, den du deinen Festen und Arbeiten zugrundelegst, auch sehr starr und straff organisiert ist.
HG: Der Jahreszeitenzyklus ist ein kompliziertes Zusammenspiel zwischen Sonnen-, Mond- und Erdkonstellation. Ich erforsche im Grunde nur die Strukturen dieser alten Symbole. Du musst ja, wenn du ein solches Fest neu schaffen willst, wissen, welche Symbole gehören zu einem bestimmten Fest. Ich bin nicht dafür, sich das aus der Phantasie zu saugen. Das wird allenthalben und oft gemacht: aber das ist für mich nicht ein ernsthaftes Wiederaufgreifen dieser Muster, die ja in sich auch Schlüssel haben, Schlüssel für spirituelle Abläufe, die wir erst erforschen wollen. Darum bin ich da sehr streng und beharre auf diesen Strukturen.
Nur, eine offene Struktur ist etwas anderes als ein vorgefertigtes Gebilde, das wir imitieren. Eine offene Struktur ist, wenn du ein z.B. Musikstück nur in Kontrapunkten hast, dann aber die Melodien frei erfindest. Wenn du etwa das Wintersonnwendfest, dieses alte Symbol der Wiedergeburt der Sonne, nimmst, da musst du dich fragen: Was kann denn das für uns heute bedeuten?
Und das heißt, du musst es auch gesellschaftskritisch nehmen. Was heißt es, wenn du es patriarchal mit all den Verzerrungen zurückverfolgst? Da fängst du an zu denken, zu suchen, und kulturhistorisch zurückzugehen, was das früher vielleicht mal geheißen hat, unabhängig von der Unterscheidung in Gut und Böse, von der Vorstellung, dass das helle, gute, schöne Licht, das männliche Prinzip, aus der dunklen, niedrigen usw. Erde kommt. Da öffnet sich ein neuer, weiter Raum, der jenseits des dualistischen Denkens und jenseits aller Verzerrungen dieser Symbole ist; und dann fängst du an, es wieder neu zu kreieren.
Aber wir halten uns an die Symbole. Wir können ja auch nicht im Frühling Getreide schneiden; im Herbst kein Frühlingssymbol feiern und im Frühling kein Herbstsymbol. Sie müssen auch stimmen, darauf bestehe ich dann schon. Das grenzt eine absolute, subjektive Freiheit der Kreativität ein, das weiß ich. Auf der anderen Seite haben wir die Erfahrung gemacht, dass, wenn du eine offene Struktur hast, eine unglaubliche Kreativität einfließen kann, wenn du das kulturhistorisch wendest. Die Kreativität, die du ansprichst, ist die Autonomie des Künstlers, der aus sich heraus immer alles darf und schafft seit der Genie-Ästhetik des 18. Jahrhunderts; die ist noch ziemlich jung. Aber auch in unseren europäischen mittelalterlichen Kulturen und danach noch gab es diese Art von Kreativität nicht. Auch da schuf man alte, reiche Symbolmuster nach, interpretierte und kreierte sie neu.
Ästhetik – Spiritualität
US: Ich habe eine Frage, die daran anschließt: Ist „Ästhetik“ und „Spiritualität“ für dich eigentlich identisch oder …
HG: … das ist nicht identisch. Meine These ist ja, dass die Absonderung der Bereiche in Kunst und Religion und Wissenschaft – alles schön geordnet und in Institutionen verankert – eine typisch patriarchale Gesellschaftserscheinung ist. Im Grunde ist es egal, an welcher Ecke du anfängst, wenn du diese gesteckten Grenzen überschreiten willst. Wenn du von der Kunst her den Zugang zur Spiritualität gewinnst oder aber von der Wissenschaft her, dann ordnet sich der Entwicklungsweg anders; denn künstlerische Ausdrucksformen sind etwas anderes als spirituelle Ausdrucksformen. Die Gebiete gehen jedoch nicht eklektizistisch ineinander über, sondern bekommen einen Zusammenhang, wenn man sie nicht als gesonderte Bereiche und gesonderte Spielregeln betrachtet, sondern, wie ich sage, als eine ganzheitliche Konzeption in Bezug auf die Gesellschaft und die Menschen.
AvP: Meint „Spiritualität“ für dich das Element dieser Einheitlichkeit des Menschen hinsichtlich seiner verschiedenen Fähigkeiten, oder verstehst du darunter wiederum eine eigene Kraft, neben den anderen Fähigkeiten?
HG: Was heißt eigene Kraft oder nicht-eigene Kraft? Wenn du sagst „eigene Kraft“, hast du wieder ein Ressort für sich. In dem Sinne ist es keine eigene Kraft. Ich sage es mal in einem alten mythischen Ausdruck, der auch heute bei spirituellen Arbeiten, zum Beispiel bei den Hopi, noch gebraucht wird: es ist die „kosmische Balance“ zwischen allem. Die kosmische Balance zwischen den Kräften im Menschen, zwischen den Bereichen in der Gesellschaft oder auch die kosmische Balance zwischen Mensch und Natur. Dies sich immer ins Bewusstsein zu bringen, immer in dieser Richtung zu arbeiten, das ist das Spirituelle. Das ist keine eigene Kraft, die man eigens institutionalisieren kann, sondern gerade die grenzüberschreitende Kraft. Aber es ist natürlich eine bestimmte Kraft, der man sich bewusst werden kann, weil sie sich abhebt von der nur ästhetischen oder nur wissenschaftlichen Kraft.
AvP: Also die Kraft, die die Balance bringt.
HG: Die synthetisierende Kraft – obwohl, das ist auch wieder so ein etwas blasser philosophischer Ausdruck –, die die Auflösung von Verfestigungen in Ressorts und Institutionen, die die Verengung auf Innerpsychisches oder Innergesellschaftliches dazu bringen kann, den Blick auf den Kosmos im Sinne von Natur zu bekommen.
AvP: Wieso trennst du das eigentlich von der dialektischen Form ab? Dialektik versucht ja auch, die Unterschiedlichkeit der Gegensätze aufzuheben und in eine Einheit zu bringen.
HG: Das dialektische Denken ist in der Philosophiegeschichte im Grunde noch ein Relikt, ein Rest dieses alten kosmischen Sich-Befindens in vielen Himmelsrichtungen, Polaritäten, menschlichen Gegebenheiten usw. Es ist, glaube ich, eine rationale Formulierung dessen. Das beginnt schon mit der platonischen Dialektik und setzt sich durch die ganzen Varianten der Dialektik bis zu Hegel und später fort. Es ist eine rationalistische Aufarbeitung dessen, was Völker in den nicht-patriarchalen Gesellschaften spirituell dauernd tun, indem sie sich, ob sie nun mental, psychisch oder praktisch arbeiten, in diesen Bezug zum Gesellschaftsganzen, zum Ganzen der Kräfte im Menschen oder auch zum Naturganzen setzen. Ich glaube, in der Philosophie ist das noch so ein Nachhall. Eine Verzerrung liegt allerdings darin, dass es rein auf dem rationalen, dem Denkbereich formuliert worden ist. So fängt es bei Plato an, bei Hegel wird es dann als eine Kosmogonie formuliert und erst in der Marx’schen Dialektik wird es dann wieder auf das Gesellschaftsganze gewendet. Nur ist es da immer wieder fast wie technifiziert durch dieses „These – Antithese – Synthese“. Es ist fast eine Technik dessen, wie man sich mit vielen Bereichen in Bezug setzen kann, – als ob das so schrittweise ginge. Aber ich würde sagen, innerhalb der Philosophie ist das noch ein Rest alter Denkformen.
Man hatte das in poetisch-musischer Form in den urphilosophischen Gesellschaften; dort kam das oft vor als das paradoxe Sprechen des Dichters. Die dichterische, poetische Sprache, die in alter Zeit eine magische Sprache war, sprach sich gerade in solchen Paradoxien, scheinbaren Widersprüchen und Gegensätzen aus. Bei Plato beginnt dann die Rationalisierung dieser Haltung. Was in den matriarchalen Kulturen eine Haltung war, ist bei den Philosophen dann zu einer Denkschule geworden. Ich sage das manchmal als Anekdote: Wenn Hegel am Schreibtisch sitzt und durch sein dialektisches Denken die ganze Welt einzuholen versucht. Es ist der Unterschied, ob du es lebst oder am Schreibtisch dialektisch nur einholst.
Dialektik und Praxis
US: Da schließt sich mir die nächste Frage an: Ist das nicht eine Ästhetisierung von Leben?
HG: Da muss ich zuerst noch zum Begriff was sagen. Ob ich es „Ästhetisierung des Lebens“ nenne, oder ob ich sage, es ist das dialektische Eine als Haltung, – das sind im Grunde alles Begriffshülsen, die diese Haltung der kosmischen Balance, die sich auf Mensch, Gesellschaft und Natur bezieht, zu umschreiben versuchen. Wir haben eben nur diese Begrifflichkeiten aus unserer philosophischen Tradition. Ich habe das eben anhand der Ästhetik formuliert und gezeigt, dass die matriarchale Ästhetik im Grunde ja keine Ästhetik ist, sondern die Fähigkeit, jene Balance herzustellen. Das ist gemeint mit Ästhetisierung. Du kannst genauso gut sagen, das sei eine Politisierung oder ein matriarchaler Wissenszugang; die Begriffe spielen da nicht so eine große Rolle.
US: Ich habe nur deinen Begriff aufgegriffen. Was ich eigentlich wissen wollte, ist, wie sich das in dieser Gesellschaft gestalten kann.
HG: Weißt du, in dieser Gesellschaft kannst du – ich habe das etwas angedeutet am Ende meines Buches – nur in kleinen Experimenten, in kleinen Enklaven beginnen. Diese kosmische Balance mit ihren Vielheiten herzustellen, ist eine Utopie, ein utopischer Gedanke, den man als Leitidee da einbringt. Wie gesagt, ich arbeite jetzt seit zwei Jahren auch praktisch, indem ich das alte Muster, das alte Mysterienspiel des Jahreszeitenzyklus benutze, in das sehr viele Möglichkeiten einfließen können. Deswegen arbeite ich in sehr kleinen Gruppen mit Frauen zusammen, in denen wir versuchen, unsere intellektuelle Durchdringung, unsere ästhetische Ausdrucksfähigkeit und unsere musischen Begabungen, unsere seelischen Fähigkeiten in einen ganzheitlichen Spielablauf zu bringen. Das sind Versuche, um uns klarzumachen, welche Geistigkeit hinter diesem Muster der alten Mysterienspiele steckt, welche Vielfalt und welche nicht-patriarchalen Verhaltens- und Lebensmuster. Das ist die jetzige, rein experimentelle Situation. Ob das mal für mehr Menschen interessant wird und seinen experimentellen Charakter verliert, das weiß ich jetzt nicht. Ich gehe da so bescheiden vor wie andere junge Menschen. Du kannst natürlich eine Leitidee haben, einen Entwurf, der vielleicht gesellschaftsverändernd ist. Aber wir fangen ja nicht mehr mit großen Strategien von oben an, sondern mit den kleinen Experimenten, da wo wir sind. Das halte ich auch für realistischer.
Bärbel Duft (BD): Ist all dies nicht ein Rückzug aus der Gesellschaft? Das ist, scheint mir, ein wichtiger Punkt.
HG: Ich will erst eine kritische Frage an dich stellen: Was ist denn ein Rückzug aus der Gesellschaft? Wissen wir das so genau? Goethe hat einmal ein schönes Wort über den Dichter gesagt: Wenn man sich mit der Kunst beschäftigt, ist das der sicherste Weg, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen und zugleich sich mit ihr zu verbinden. Darin liegt eine Paradoxie. Ich sage es dir jetzt aus meiner Sicht: Wenn du in eine sehr intensive Arbeit spiritueller Art einsteigen willst, musst du dich erst mal zurückziehen; sonst ist das gar nicht möglich. Dass ich mich aber nicht zurückziehe, siehst du daran, dass ich zugleich extensiv arbeite mit Büchern und Vorträgen, durch die ich glücklicherweise viele Menschen erreiche. Auf lange Sicht möchte ich natürlich diese intensive Arbeit – darum habe ich auch von der Dokumentation gesprochen – wiederum vermitteln. Mein Ziel ist jedoch auch nicht – das habe ich eben jahrelang erlebt –, mich mit Bücherschreiben und Seminarehalten tot zu hetzen und vor lauter Weitergeben jegliche innere Substanz zu verlieren. Das ist eine Balance, beides zusammenzuschließen; wie ich das praktisch tue, muss ich ein Leben lang neu erfinden. Ich bin aber auch eine Gegnerin von insiderisch spirituellen Gruppen. Ich habe mir da unter den Frauen, die so daran hängen, schon genügend Feindinnen gemacht, weil ich sage, das führt nicht weiter, das führt irgendwann zur Erstarrung. Die Auseinandersetzung mit der Kultur, in der wir sind, dauernd wieder zu leisten, ist Teil der spirituellen Aufgabe. Man kann sich nur teilweise zurückziehen, dann muss man sich wieder auseinandersetzen; denn keine Insel in unserer Kultur ist eine echte Insel.
Mann und Frau im Patriarchat
AvP: Bei dem, was du bislang über Spiritualität, Kunst und die Symbole gesagt hast, habe ich eigentlich nichts ausschließlich Frauenspezifisches herausgehört. Was ist denn nun das, von dem du meinst, es gelte nur für Frauen?
HG: Von meiner theoretischen Seite her mache ich längst nicht nur Arbeit für Frauen, sondern meine, eine ganze Gesellschaftsform zu untersuchen und eine andere zu kritisieren. Das ist, denke ich, eine ganz allgemein philosophisch wichtige Arbeit und richtet sich an Frauen und Männer; obwohl es natürlich etwas anderes ist, die Geschichte einmal konsequent unter der Perspektive einer von Frauen geprägten Gesellschaftsform zu untersuchen.
Im Praktischen habe ich jetzt wirklich nur von Frauen gesprochen, aus einem bestimmten Grund. Ich habe keine separatistischen Gründe, sondern einfach keine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Männern. In meiner zweijährigen Arbeit waren allein so viele Schwierigkeiten zu bewältigen, erstmal uns Frauen aus den inneren patriarchalen Mechanismen raus zu lösen, dass ich im jetzigen Stand schlicht überfordert bin, auch noch die Probleme in Bezug auf die Männer mitzulösen.
Zum anderen habe ich das Gefühl, dass der Weg, den manche Männer begonnen haben, noch einige Jahre allein für sie weiter gehen muss, ehe sie soweit sind, dass man das mal kombinieren kann. Allein! Was glaubt ihr, wie viele Jahre Frauen, die heute in der Öffentlichkeit auftreten, allein ihren Weg gegangen sind: im Nichts zwischen allen Geschlechterrollen? Also meiner war mindestens zehn Jahre lang in völliger Isolation. Junge Männer, die heute weiterkommen wollen, müssen auch mal diese Phase der alleinigen Entwicklung durchgehen. Das sind existentielle Erfahrungen, die Frauen den Männern und Männern den Frauen nicht abnehmen können.
Genauso wie ich mich dafür interessiere, wie Frauen langsam zu einer Art matriarchaler innerer Souveränität kommen – nicht nur Selbstbewusstsein, das ist zu flach und psychologisch, sondern wirklich eine Art innerer Souveränität –, interessiert mich, wie Männer sich aus diesen patriarchalen Verklammerungen lösen und zu einer Art matriarchaler Integrität kommen können – so bezeichne ich das für Männer.
Aber die Nicht-mehr-Berührbarkeit von diesen ganzen patriarchalen Verführungen ist für Männer schwerer als für Frauen; denn das System absorbiert sie mit vielen Hilfestellungen immer wieder. Da die Integrität zu wahren, ist nicht leicht für einen Mann heute.
Wir sind ja in einer patriarchalen Gesellschaft nicht ganz in symmetrischen Positionen. Das Patriarchat, wie bedrückend es auch immer auf Männer wirkt, gibt ihnen mehr Chancen als Frauen. Insofern glaube ich, wird auch ein ehrlicher Bewusstseinsprozess bei Männern etwas anders verlaufen als bei Frauen. Und das sollen Männer wirklich allein tun.
US: Wäre das dann aber nicht das Aufrechterhalten der unterschiedlichen Geschlechtsmerkmale?
HG: Es sind nicht verschiedene Geschlechtsmerkmale, sondern unsere geschichtlichen Positionen sind heute verschieden. Die geschichtliche Position von Frauen, von bewussten Frauen, ist heute anders als die von Männern. Wir leben noch immer in einer patriarchalen Gesellschaft, die diese Asymmetrie mit sich bringt. Ich beobachte mit großer Freude, wenn aufgeschlossene Männer mehr und mehr ihren eigenen Weg suchen; denn das ist die Vorstufe, dass auch mal, auf dieser hohen Bewusstseinsebene, eine kreative Begegnung stattfinden wird.
AvP: Für mich ist das von dem, was du geschrieben hast, insofern unterschieden, als sich mir dort der Gedanke aufgedrängt hatte, du versuchst matriarchale Formen nur zu entwickeln, um zu fordern, nachdem 2000 Jahre lang die Männer geherrscht haben, soll das mal umgedreht werden …
HG: 4000 Jahre, Alexander.
AvP: Das kommt wahrscheinlich auf die Kulturen an.
HG: Hier waren es 4000 Jahre.
AvP: … in der Rückbesinnung auf die alten Formen von der Göttin und ihrem Heros.
US: Aber Alexander, du weichst aus.
HG: Das steht wirklich nirgendwo in meinen Büchern! Ich kritisiere immer diese simplifizierende Umkehrung, das Matriarchat sei praktisch nur die umgekehrte Herrschaftsform des Patriarchats. Wenn man das so sieht, dann kommt die Abwehr der Männer auf dem Fuße. Das kritisiere ich dauernd und dauernd. Wenn ich eine matriarchale Gesellschaftsform untersuche – ich sage das auch an vielen Stellen –, dann geht es mir nicht nur darum, wie eine neue Selbstauffassung der Frauen im matriarchalen Sinn, auf einer höheren Bewusstseinsstufe, aussieht, sondern auch der Männer. Ich denke an beide. Das ist ja gerade das, was mich auch von vielen Feministinnen unterscheidet, die ausschließlich Frauenperspektiven und Frauenstandpunkte untersuchen. Ich untersuche keinen ausschließlichen Frauenstandpunkt, sondern eine Gesellschaft, die von Frauen bestimmt war, nämlich das Matriarchat. Für mich ist es faszinierend, je mehr ich da eindringe, mit welcher erstaunlichen sozialen Intelligenz diese matriarchalen Gesellschaften geführt worden sind. Die funktionierten nämlich, ohne dass man, wer weiß, welche Autoritäten, Befehlsgewalten und Herrschaftsmechanismen einführen musste. Das ist aus utopischer Sicht höchst faszinierend: Dort waren Männer in ihren Eigenheiten in das ganze Gefüge integriert, hatten verschiedene wichtige Rollen und Bedeutung. Man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass sie in ihre Fähigkeiten unterdrückt wurden; sie waren so voll integriert, dass das wirklich wie in einer ‚kosmischen Balance‘ funktionierte. Das ist nicht nur Theorie, das haben die sehr gut praktiziert.
Mir wird manchmal vorgeworfen, ich sähe das etwas rosig und idealisierend. Da möchte ich nur mal auf das noch immer klassische Buch von Lewis Morgan verweisen, der die Gentilgesellschaften bei den Irokesen beschreibt. Die Stammes- oder Gentilgesellschaften haben tatsächlich über die Verwandtschaftsbeziehungen wunderbar funktioniert, und zwar herrschaftsfrei; und die waren matriarchal geprägt. Es gibt Theoretiker wie Christian Sigrist, die solche Konzepte wieder aufgreifen, mehr und mehr solche Gesellschaftsformen untersuchen, die hoch komplex waren, gut organisiert und trotzdem herrschaftsfrei, nämlich ohne Hierarchie, funktionierten. Er nennt sein Buch „Regulierte Anarchie“, Anarchie heißt Herrschaftslosigkeit, aber eben nach Regeln. Und das waren großenteils matriarchale Gesellschaften.
BD: Das Vorurteil, dass das Matriarchat die Umkehrung des Patriarchats sei, finde ich ganz bezeichnend. Was mich erstaunt, ist, dass auch Frauen auf dieses Urteil reinfallen. Das ist ja an und für sich ein Ausdruck patriarchalen Denkens, dass es gar nicht anders vorstellbar ist, als dass eine Gesellschaft herrschaftlich und hierarchisch funktioniert. Man muß ganz schön alt werden, um das zu durchschauen.
HG: Weißt du, ich arbeite schon zwanzig Jahre an der Materie; ich habe dabei Stunde um Stunde meine eigenen Vorurteile abstreifen müssen. Weil das, was ich da las, war so verquer zu unseren Denkweisen, dass ich das wirklich nur langsam begriff. Was du sagst von der Umkehrung, dass in Matriarchaten eben die Mütter geherrscht haben und die Männer auch unterdrückt wurden, das ist wirklich ein schlicht banales Vorurteil, das dauernd reproduziert wird, weil es natürlich herrschenden Kreisen und der herrschenden Wissenschaft passt. Aber ich kann nur sagen: Leute, die das wiederholen, ob Männer oder Frauen, haben wirklich keine Ahnung von der Materie! Die haben noch kein wirklich zureichendes Buch aus diesem Gebiet gelesen. Denen würde ich sagen: Lest nur mal, bitteschön, Morgan, nur mal diese eine klassische Schrift; dann kriegt ihr ein völlig anderes Weltbild! Die kennen meistens nichts. Ich werde dann immer, in der Vortragssituation, leicht wütend, wenn das wieder und wieder kommt.
Matriarchat: Umkehrung des Patriarchats?
GS: Auch auf diese Gefahr hin … Du schreibst in deinem Buch über matriarchale Gesellschaften, die Frau sei die Schöpferin der Kunst und der Gesellschaft. Und der Mann – wo hat der seine Rolle? Wie konnte sich aus diesen matriarchalen Strukturen, die relativ herrschaftsfrei funktioniert haben, die patriarchale Herrschaftsform entwickeln? Und wie gehen wir heute damit um, wenn wir gegen diese Herrschaftsform eine Gegenbewegung schaffen wollen?
HG: Das ist ein ganzes Bündel schwierigster Fragen auf einmal. Was die Rolle von Männern in Matriarchaten angeht, kann ich dir nur sagen: in Stammesgesellschaften gelten sie nichts in der Sippe der angetrauten Frau, sondern nur in der Sippe ihrer Mutter. Und dort sind sie als Söhne oder Brüder geachtet und vertreten oft die Sippe nach außen. Solche Männer, die verhandeln oder bei Kriegen eine ganze Sippe oder einen ganzen Stamm nach außen vertreten, – das habe ich aus heutigem Material erschließen können – treten mit ganz anderer Würde und ganz anderem Verantwortungsgefühl auf, als wenn einer nur sich selbst und seine Machtposition vertritt.
Dann gibt es andere Formen, wo Männer und Frauen getrennte Bereiche haben. Die Frauen haben das häusliche und das dörfliche Leben bestimmt, während die Männer ihre Organisation in freier Natur gehabt haben, auf Jagden oder bei der Kriegsführung, das hat man in Nordamerika gut beobachten können. Das hat aber nicht die dominante Stellung der Frau in den sesshaften Bereichen, den Pueblo- oder Zeltstädten, tangiert; das war nach Bereichen getrennt.
Bei den hochkulturellen Matriarchaten des matriarchalen Königtums haben wir dann eine interessante Erscheinung. Das war kein autonomes Königtum wie in den patriarchalen Gesellschaften, sondern bezogen auf Tempelzentren und auf die Priesterinnen, die dort tätig waren. Diese Könige hatten die Aufgabe, die Männer für oft komplizierte Bautätigkeiten zu organisieren. Das fängt an bei den Bewässerungssystemen dieser hochkulturellen Matriarchate der alten Induskultur, in Altägypten, der ältesten Euphrat- und Tigriskultur; das war keine gering geschätzte Aufgabe. Daraus ergab sich eine erweiterte Bautätigkeit, die dann in Landgestaltung, in Steinaufbauten bis hin zu Tempelbauten bestanden, auch das war die Aufgabe der Männer. Aber wie und was, unter welchen symbolischen und spirituellen Zusammenhängen gebaut wurde, das haben die Priesterinnen im Tempelzentrum bestimmt; denn sämtliche Bauanlagen waren symbolisch und spirituell, deren spirituell mythischer Geist in den Tempelzentren vertreten wurde. Heute starrt die Archäologie meist auf das Königtum und die phantastischen Dinge, die gebaut wurden, und weiß überhaupt nicht mehr, dass im Hintergrund die Prägerinnen dieser Bauwerke und -tätigkeit saßen. Deswegen gibt es in Geschichtsbüchern so herrliche Fehlurteile: Sobald ein König auftritt, der eine Pyramide baut, ist das schon eine patriarchale Kultur; was überhaupt nicht stimmt, weil man das Sozialgefüge zwischen Tempelzentrum und Königshaus missachtet oder nicht kennt. Das spiegelt sich auch in der Mythologie wider. Der Sonnenheros, der in diesen Mysterien und Zyklen auftritt, ist ja keine unterdrückte Person, sondern wird manchmal fast zum Zentrum des Ganzen. Doch das ist dann unserer Perspektive; das Zentrum ist nicht er, sondern, ich sage es mal mythologisch: so wie die Sonne ein Teil des ganzen Gestirnhimmels ist, ist er ein wichtiger Teil des Gestirnhimmels, aber nicht das Zentrum. So wurde das auch tatsächlich aufgefasst. Die Frauen dieser alten Kulturen jedenfalls würden lachen, wenn man ihnen sagte: Ihr unterdrückt die Männer, die würden sagen: „Unterdrückt die Nacht die Sonne?“
Erklärungsmodelle patriarchaler Gesellschaften
HG: Dann hast du gefragt, wie das mit den Umschwüngen war. Dazu gibt es viele Thesen. Lauter einlinige Thesen, die für alle Kontinente, zu allen Zeiten, bei jeder Bedingung stimmen sollen. Davon halte ich nicht viel. Ich versuche, in meiner neuen Arbeit diese Umschwünge gesondert zu untersuchen. Im eurasischen Raum hat es keine immanenten Mechanismen gegeben, sondern wahrscheinlich eine Entwicklung, die durch katastrophale Existenzbedingungen zustande gekommen ist und in der Folge zu katastrophalen Völkerwanderungen geführt hat. Diese Stämme haben im Zusammenbruch ihrer eigenen Gentilverfassung gelebt und kamen praktisch als Räuber in die alten matriarchalen Hochkulturen im Mittelmeerraum und im Vorderen Orient. Ich sage „Räuber“ jetzt nicht abwertend, sondern im Sinne von Menschen, die ohne jegliche Sozialstruktur lebten, weil sie Generationen lang Katastrophen hinter sich gebracht hatten. Die kamen in ihrer desolaten Verfassung in ein Land, das reich war und wo der Ackerbau blühte. Wahrscheinlich hatten sie gar keine andere Wahl, als es zu erobern; als sie es erobert hatten, hatten sie keine andere Wahl, als ihre Herrschaft zu sichern. Sobald diese Überlagerung kam, kommen erst mal dunkle Jahrhunderte, in denen man archäologisch fast nichts mehr findet. Daraus haben sich dann die ersten „Zwei-Schichten-Staaten“ gebildet, in denen diese Räuber aus Existenznot ihre kriegerischen Mechanismen einsetzten, die die anderen Kulturen nicht kannten. Dadurch setzten sich dann, weil das Männer waren, das Übergewicht der Männer, der Kriegstechniken und damit der Herrschaft durch. So entwickelte sich Patriarchales.
Das ist die These, wie durch katastrophale Klimaverschiebungen und entsprechende Völkerwanderungen in Europa und Asien die Verhältnisse verlaufen sein könnten. Darüber hinaus besteht immer noch das Problem, wie in anderen Gesellschaften, die nicht solch extreme Bedingungen erlebt haben wie im Pazifik oder in Afrika, immanent die Umschwünge geschehen sind. Ich muss sagen, da habe ich des Pudels Kern auch noch nicht ganz gefunden.
Es gibt einige Theorien, besonders von marxistischen Theoretikern, wie durch Anhäufung von Heiratsgut oder Gütern, die durch gegenseitigen Sippentausch sich in einer Hand häuften, ein Übergewicht einzelner Männer entstanden ist – sie nennen das dann schon ‚Privateigentum‘, was auf dieser frühen Stufe bestimmt nicht gilt, weil das Bewusstsein von Privateigentum gar nicht vorhanden war –, und ihnen dadurch auch mehr Möglichkeiten gegeben wurden, Handel zu treiben. Wie durch dieses Übergewicht sich langsam auch ein stärkeres Bewusstsein herausgebildet hat, das zur Patrilinearität geführt hat, und dann zum Übergewicht von Häuptlingen, die sich allmählich unabhängig machten; wie also stufenweise, durch Bewusstseinsstufen hindurch, Patriarchate entstanden sind – all das wären Theorien immanenter Mechanismen. Auf keinen Fall aber taugen solche Erklärungsmuster, dass durch Erfindung eines einzigen Gerätes wie des Pfluges oder einer einzigen neuen Wirtschaft des Getreidebaus oder einer einzigen neuen Erkenntnis wie der Vaterschaft schlagartig und plötzlich das Patriarchat entstanden sei. Diese Entstehungsprozesse dauern jahrhundertelang und sind Prozesse der Verschiebung von Gütern, von Technologie und Bewusstsein auf die Seite der Männer. Doch das muss man im Einzelnen nachforschen, man kann da keine Bausch-und-Bogen-These machen; und das ist ein Teil meiner Forschungsaufgabe.
AvP: Ich habe eine Frage, die spiegelbildlich dazu ist: was wären für dich die Gründe und Ursachen, die die Abschaffung und Überwindung des Patriarchats in der Gegenwart möglich machen? So wie in einem langen Prozess das Patriarchat entstanden ist, so deuten heute bestimmte Faktoren darauf hin, dass das Patriarchat nicht mehr haltbar sein könnte.
HG: Also, in einem Punkt muss ich manchen Forscherinnen und Forschern eine Illusion nehmen. Manche glauben nämlich, wenn man die Mechanismen kennt, wie das Matriarchat zum Patriarchat umschlug, könne man das vice versa wieder umdrehen. Das geht überhaupt nicht. Erstens gibt‘s nicht eine Ursache und einen Mechanismus, sondern das sind lange komplizierte Entwicklungen; und zweitens sind die historischen Bedingungen heute so anders, dass man nicht durch die Umkehr irgendeines Mechanismus wieder ein Matriarchat herstellen kann. Das ist schlicht eine Illusion; da hat man ein rein mechanistisches Geschichtsbild.
Was für mich so spannend an dieser Forschung ist, dass ich, je mehr ich mich mit der matriarchalen Gesellschaftsform beschäftige, desto deutlicher erkenne, was an patriarchalen Mustern und Strukturen, an Bildern, Verhalten und Vorstellungsweisen eigentlich alles existiert. Wir unterschätzen das, weil wir das so gewöhnt sind. Und wenn man die überwinden will, muss man sie sehr genau kennen. Darum liegt mir sehr daran, das Patriarchat in seiner Entwicklung und in seinen Mustern bis heute genau zu erfassen. Und aus der Erforschung der alten Matriarchate kommen uns vielleicht Anregungen, in welche Richtung man es überwinden könnte. Aber nur das, nur die Richtung; weil die Imitation einer historisch vergangenen Gesellschaftsform nicht möglich ist.
Ende des Patriarchats
AvP: Meine Frage war ja: Kann man das Patriarchat überhaupt überwinden? Gibt es Argumente, die besagen, dass es nicht nur ein Mit-dem-Kopf-an-die-Wand-Rennen, sondern von der Struktur her auch möglich ist?
HG: Weißt du, das Patriarchat mit seinen Strukturen wird mehr und mehr Menschen dubios; nicht nur Frauen erkennen das und leiden darunter – mehr und mehr Männer auch. Mittlerweile hat unsere Technologie, unsere Strategie und unser militärisches Denken, die ökologischen Probleme und die der Gesellschaft, die Brutalität und Kriminalität unserer zerrütteten Gesellschaft einen Grad an Absurdität erreicht, dass immer offensichtlicher wird, welche Sprengkraft darin liegt. Das ist nicht nur eine Gegenwartsaufnahme, sondern das sind grundlegende Gegensätze, Widersprüche und Brüche, die sich mehr und mehr verstärken.
Sie zeigen, dass die patriarchale Gesellschaft sowohl in ihrem Verhalten gegenüber der Natur, als auch gegenüber den Menschen und im Verhalten der Staaten untereinander dermaßen absurd geworden ist, dass wohl kein vernünftiger und aufgeschlossener Mensch heute diese Gesellschaftsform noch für entwickelbar hält. Ich habe absichtlich an die Absurdität der Waffenrüsterei erinnert, die ja mittlerweile so gigantisch ist, dass sie – hoffentlich – nicht mehr anwendbar ist. So geht’s auch den menschlichen Beziehungen, wo die Atomisierung des Individuums so weit gediehen ist, dass die Vereinzelung, die Isolation und die Einsamkeit bald nicht mehr tragbar ist.
Das ist so was wie ein Endpunkt einer Entwicklung, die in einer Gesellschaft begann, der Gentilverfassung, in der jede Person im Rahmen dieser Verwandtschaftsordnung irgendwo aufgehoben war; die wurde dann zerschlagen in die patriarchale Großfamilie, die sich um einzelne Männer gruppierte; die wurde dann zerschlagen in die patriarchale Kleinfamilie; und heute wird die patriarchale Kleinfamilie noch zerschlagen. Das Ende ist ein isoliertes, einsames, atomisiertes Individuum, das staatlichen oder sonst welchen Manipulationen hilflos ausgesetzt ist. Dies ist ein Endpunkt; denn danach kann man nicht noch etwas atomisieren. Auch das ist eine Absurdität.
BD: Diese Widersprüche, diese negativen Eigenschaften unserer heutigen Gesellschaft werden sicher von immer mehr gesehen. Aber es gibt nur wenige Menschen, die das mit dem „Patriarchat“ in Verbindung bringen.
HG: Weißt du, es ist die Aufgabe meiner historischen Forschung, diese Traditionslinie zu zeigen. Darum habe ich daran erinnert, wie eine nicht-hierarchische Gemeinschaft mehr und mehr zerschlagen wurde bis zu diesem absurden Endpunkt heute. Er ist wichtig, dass wir das nicht nur als Crux unserer modernen Gesellschaft sehen, sondern als eine konsequente patriarchale Entwicklung durch ihre wirklich menschenverachtende Einstellung. Das Ergebnis ist das, was wir heute haben. Es ist ja keineswegs nur die Frauenbewegung; es sind mehr und mehr denkende Männer, die kritisieren, die New-Age-Bewegung, die Alternativbewegungen; egal an welchem Punkt angefangen wird – die Wunden sind so offensichtlich, dass diese Kritik häufiger, vielschichtiger und immer dringender wird. Und das sind für mich Zeichen dafür, dass diese Gesellschaftsform, in der wir leben, nämlich das Patriarchat, am Ende ist.
Systemveränderung durch Basisvernetzung?
HG: Gerlinde, du hast vorhin noch gefragt: Wie ist es möglich, aus einer herrschaftsdurchsetzten zu einer nicht-herrschaftsdurchsetzten Gesellschaftsform zu kommen? Das ist echt ein Kunststück.
Es ist natürlich einfach, in einer herrschaftsfreien Gesellschaft Herrschaft einzuführen, indem einige plötzlich ihren Egoismus entdecken und die Vorteile auf sich häufen. Aber wie löst man aus einer herrschaftsdurchsetzten sich wieder heraus? Das ist wirklich ein großes Problem. Ich kann euch das auch nicht schlicht und einfach beantworten. Ich kann euch bloß meine persönlichsten Ideen dazu sagen und euch das ins Gedächtnis rufen, was schon viele Menschen versuchen: nämlich nicht wieder mit einer großen Strategie, d.h. Revolution von oben oder unten, in der die Menschen wieder hierarchisch gegliedert werden, je nachdem, wie weit ihr Bewusstsein gediehen ist; sondern so, wie es heute eigentlich probiert wird: in kleinen Gruppen, an vielen Orten, an vielen Stellen konkret anzufangen, Verhaltensformen und Gesellschaftsformen zu ändern. Und diese Gruppen sind in meinen Augen schon nicht mehr einzelne subkulturelle Erscheinungen, sondern das ist schon zu einem Netz geworden.
Und das ist deswegen so interessant, weil dieses Netz gar nicht herrschaftsdrohend gegen die Herrschenden vorgeht, sondern dem die Herrschenden einfach gleichgültig sind. Die gliedern sich, so weit sie können, aus den Hierarchien, Institutionen aus; leben dafür natürlich bescheiden, oft überbescheiden. Aber dadurch unterlaufen sie all das, was von ihnen erwartet wird. Sie unterlaufen, was von den Menschen erwartet wird, den Ehrgeiz, in der Hierarchie aufzusteigen, dass man dauernd am Konsum und Reichtum teilhaben muss; sie unterlaufen das. Und das ist für Leute, die dauernd in den Vorstellungen von Herrschenden und Beherrschten, die dann auch herrschen wollen, denken, höchst verwirrend. Es ist fast so, als ob denen der Boden unter den Füßen wegschmilzt, bis solche Riesen auf tönernen Füßen stehen.
GS: Das ist doch aber ein ganz wunder Punkt. Denn in dem Moment, wo sich das Netz so entwickelt hat, dass es als eine Gefahr gesehen wird, könnte es ja sehr massiv bekämpft werden. Es ist ja nicht so, dass die Herrschenden auf einem so niedrigen Stand sind, dass sie uns egal sein könnten. Kann man das wirklich so alternativ unterlaufen, wenn die Geschichte des Patriarchats doch gezeigt hat, wie es es geschafft hat, die matriarchalen Elemente zu unterdrücken?
HG: Ich habe vorhin nur geschildert, wie es heute verläuft. Dass vielleicht, wenn es zu viele werden, massiver Druck von oben kommt, ist ja nicht ausgeschlossen. Nur, es gibt heute Faktoren, die eben anders sind als früher. Man kann heute, wenn sehr viele Menschen nicht mehr in diesen Hierarchien und Institutionen mitarbeiten, nicht mehr ohne Weiteres bewusstlos mit den Waffen auf sie einschlagen. Dazu sind die Waffen heute zu gefährlich und die öffentliche Meinung zu groß und zu breit. Das klingt etwas idealistisch und naiv, wirst du vielleicht sagen, – aber ich meine, in unseren westlichen Demokratien gibt es immerhin noch einen Mechanismus, nämlich die Abhängigkeit der Regierenden von ihren Wählern. Das ist zwar in gewisser Weise formal, aber nicht ganz zu unterschätzen. Zudem haben wir Zivilisationsformen entwickelt, die auch in ihren negativen Mechanismen für viel mehr Menschen durchsichtig geworden sind, als das früher war.
Das sind Faktoren, die ins Gewicht fallen können. Ich kann nicht sagen, das läuft so; ich kann keine Prognose machen, ich bin kein Prophet. Aber ich kann darauf hinweisen, welche Faktoren heute ins Gewicht fallen können, die durchaus auch die stützen können, die anders leben wollen.
GS: Jetzt verstehe ich das. Mich hatte nur verwirrt, dass du in deinem Buch von der Öffentlichkeit im Patriarchat als einer Enklave der Ohnmacht gesprochen hast.
HG: Hab‘ ich das? Das müssen wir mal im Zusammenhang gucken; ich hab‘s bestimmt nicht in dem politischen Sinne gemeint. Du beziehst dich sicher auf die „Tanzende Göttin“; das ist essayistisch geschrieben, bitte vergiss das nicht ganz. Ich kann in einem Buch, in dem ich die Geschichte des Matriarchats und eine Patriarchatskritik im Detail ausführe, zu solchen Fragen viel detaillierter Stellung nehmen, wie ich es hier jetzt auch versuche, als in einem Buch, in dem ich mich essayistisch mit den Fragen „matriarchaler Kunst und Spiritualität“ auseinandersetze.
Feminismus und Marxismus
BD: Zum Teil bist du ja schon darauf eingegangen; aber könntest du doch noch Genaueres zu deinem Verhältnis zum Marxismus, zu den sozialistischen Revolutionen und Staaten sagen?
HG: Weißt du, ich werde oft, auch von Frauen gefragt: Inwieweit ist denn das, was du hier vertrittst auch politisch, oder wieweit kann‘s auch revolutionär werden? Da frage ich immer: Was meinst du damit? Welchen Politikbegriff, welchen Revolutionsbegriff hast du? Solange wir Politik- und Revolutionsbegriffe entwickeln – auch wenn sie von unten kommen –, wo wieder mit Kadern und abgestuften Arbeiten operiert wird, sind wir noch immer in dem hierarchischen Modell. Das zeigen ja auch die noch so interessanten Volksrevolutionen, die letzten Endes wieder zum Aufbau hierarchischer Staaten führten. Da hat schon an der Struktur der Revolution was nicht gestimmt; das waren keine Revolutionen, die von den konkreten Bedingungen von Individuen und kleinen Gruppen ausgegangen sind, sondern die wieder eine allgemeine Strategie hatten. Ich muss sagen, in dem Sinne steckt hinter dem Spirituellen oder der spirituellen Arbeit, die ich euch geschildert habe, in der Tat ein anderer Politikbegriff: verschiedene Menschen an verschiedenen Orten, die aus ganz verschiedenen Gründen kritisch aus dem System austreten, die sich gar nicht abgesprochen haben, aber durch die Entwicklung eine Art Netz ohne Dachorganisation bilden, das ist eine andere Revolution, die sich weder organisiert noch strategisch verbindet; drum ist die auch nicht zu greifen.
Man hat das ja auch in der Frauenbewegung. Die gibt‘s mal da und mal dort; das entzündet sich an immer anderen Problemen. Die haben sich doch nicht abgesprochen, die Frauen! Die haben auch keine Strategie; aber das ist dauernd virulent und dadurch von gewissen herrschenden Leuten nicht zu fassen. Das ist eine andere Art von Revolution, die weiterbringt, weil sie den Menschen nicht strategisch übergeht, sondern von ihm ausgeht. Die dauert natürlich etwas länger als die Revolution, die, wie die sozialistische, innerhalb von einer Generation eine andere Welt schaffen will.
BD: Ich könnte mir vorstellen, dass man fragt: Haben wir die Zeit dafür?
HG: Tja, du hast recht; nur, da können wir alle nichts dazu. Wir haben nur die Alternative: Wollen wir wieder so eine Hauruck-Revolution, die viele Menschen zu Tode gebracht hat und trotzdem die alten Strukturen wiederbringt; oder wollen wir die behutsame Revolution, die auf die Menschen Rücksicht nimmt …
BD: … und die andauert …
HG: … die über Generationen hinweg geht. Auch die Revolution, die das Patriarchat eingeführt hat, ging nicht von einer Generation auf die andere – obwohl zerstören immer leichter ist als aufbauen; sage ich mal etwas plakativ. Wir können nur in der Zeit, die uns gegeben ist, tun, was wir können; wie viel Zeit wir haben, wissen wir nicht. Wir kennen das aus der Friedensbewegung; die hatten auch nicht furchtbar viel Zeit, denn das Wettrüsten geht weiter. Aber sie hat versucht, Zeit zu gewinnen. Wir haben die Aufgabe, Zeit zu gewinnen; ob wir sie noch haben, ist eine metaphysische Frage, die keiner beantworten kann.
AvP: Würdest du wirklich sagen, dass die sozialistischen Revolutionen eine Weiterführung dessen waren, was patriarchale Herrschaft möglich gemacht hat? Oder sind da nicht doch Mechanismen entstanden, durch die sich auch andere Interessen haben artikulieren können, wie die Arbeiterbewegung?
HG: Es ist genauso wie bei den Demokratisierungsprozessen, durch die andere Bevölkerungsschichten auch eine Chance bekamen, sich staatlich durchzusetzen. So ist das auch in den sozialistischen Revolutionen geschehen, weil da erstmals die Arbeiterschaft ins Licht der Geschichte trat und eine Rolle und Aufgabe erhielt. Ich würde das aber deswegen noch als patriarchal bezeichnen, weil noch immer die Blindheit in Bezug auf die Situation der Frauen besteht. Die patriarchale Gesellschaft ist ja nicht seit ihrem Beginn bis heute dieselbe geblieben. Da gibt es eben soziale Revolutionen; das sind Entwicklungen weiter. Sie sind nicht zu Ende geführt worden und deswegen patriarchal, weil in ihnen noch immer die mann-zentrierte Perspektive besteht. Der Mann – ob er nun Bourgeois ist oder Arbeiter, König oder Untertan – ist immer noch Zentrum des Denkens und der Weltsicht.
Ich möchte mal an das spannende Wort von Engels erinnern, dass der erste soziale Gegensatz, und zwar der grundlegende, durch die Unterdrückung der Frau in die Welt gekommen ist. Eine schöne These von ihm und anderen marxistischen Theoretikern; nur die Konsequenz haben sie nicht daraus gezogen. Sie haben die Gesellschaftsform, die den Arbeiter, den Bourgeois usw. in Bezug setzt, nicht nochmal auf die Situation und auf die Geschichte der Frauen hinterfragt. Das ist ein gutes Programm, das unausgeführt geblieben ist und heute radikal und grundlegend wieder von Feministinnen aufgegriffen wird, die eindeutig feststellen, dass die Probleme, die mit der Situation der Frauen zusammenhängen, eben nicht gelöst sind, wenn sich die Arbeiter-Unternehmer-Gegensätze lösen, sondern viel tiefgreifender sind, weil geschichtlich älter, viel grundlegender in allen Bereichen.
AvP: Würdest du meinen, dass das eine Bedingung für das andere ist?
HG: Was Bedingung für was?
AvP: … dass die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und der Verfügung über sie – logischerweise von Männern –, also die Sozialisierung, eine notwendige Stufe ist; wobei ich dir Recht gebe, dass damit das Frauenproblem noch nicht gelöst ist.
HG: Also, das hängt zusammen. Wenn man der Engels‘schen These folgen würde, das Privateigentum sei allein der Faktor gewesen, der zur Unterdrückung der Frau durch den Mann geführt habe, dann würde logischerweise die Abschaffung des Privateigentums genügen, um die Frauen zu befreien. Aber das ist eben nicht der einzige Faktor. Es kommen noch biologische und kulturelle Faktoren hinzu; alles Faktoren, die man im Grunde nur herausbekommt, wenn man Matriarchatsforschung betreibt. Es gibt eben die verschiedene Situation von Frauen und Männern, dass Frauen zur Mutterschaft fähig sind oder Kinder haben; daß Frauen tatsächlich Kulturschöpferinnen waren und eine völlig andersartige Kultur geschaffen haben, als sie dann in den Patriarchaten entwickelt wurde. Das Privateigentum ist nur ein Faktor, wenn auch ein wichtiger, aber nur einer. Wenn man sieht, wie viele Faktoren da noch hineinspielen, um das Patriarchat zu ändern, dann muss man weit hinter die marxistische Klassenanalyse zurückgehen, auch im philosophischen Hinterfragen.
In dem Sinne ist tatsächlich die marxistische Denkweise – wie progressiv auch immer, das würde ich in keiner Weise bestreiten – doch noch eine patriarchale Denkweise, weil mann-zentriert, die Analyse der Frauensituation, auch der geschichtlichen, bleibt weg. Ebenso die Vorstellung, man könne die Geschichte erfassen auf so einer schönen Linie: so wie die Geschichte begonnen hat, so schafft man sie am Ende ab – und dann kommt die wunderschöne Utopie. Das ist eine einlinig kausale Denkweise und typisch für patriarchale Wissenschaft, ich kann mir da nicht helfen.
AvP: Ich würde da zwar mehr die dialektischen Elemente in den Vordergrund stellen, …
HG: ok., ich habe mich jetzt mehr auf Engels bezogen; da kommt das manchmal so‘n bisschen plakativ-kausal heraus.
AvP: … aber manchmal auch differenziert.
HG: Ich meine die Geschichte mit dem Privateigentum. Sobald das abgeschafft ist, verschwinden die Klassengegensätze, und alle sind befreit.
AvP: Aber es kommt von ihm doch auch anderes.
HG: Ich habe mich da jetzt nicht auf Marx bezogen, der da differenziert und dialektisch arbeitet. Nur möchte ich dir nochmal sagen: Dialektik ist in der Tat eine Schreibtischphilosophie, auch die Dialektik der Widersprüche. Mich interessiert an dem Punkt, was ich auch in meine Arbeit mit hinein nehme, um wieviel vielfältiger und reicher die Widersprüche sind, wenn man sie erlebt in praktischer Arbeit, als wenn man sie, wie gesagt, mit der dialektischen Widerspruchsphilosophie einzuholen versucht. Ich will keineswegs die Reichweite der marxistischen Analysen und ihre Bedeutung verkleinern. Aber es ist noch sehr viel Schreibtischphilosophie und patriarchale Denkweise darin, was sich eben leider in der Struktur sozialistischer Staaten mit ihrem Hierarchiegehabe wiederum ausdrückt. Aber das sind jetzt Thesen, über die könnten wir uns noch stundenlang unterhalten.
AvP: Ich glaube, da könnten wir schon zusammenkommen. Wenn Marx alte Gesellschaftsformationen studiert, dann macht er das auch sehr detailliert und ohne große Schablonen. Aber gut; da kamen dann auch wieder vage allgemeine Aussagen vor, wie bei dir ja auch, wenn du sagst, das und das sei „essayistisch“ gemeint, und wenn man‘s konkret machte, würde es natürlich komplizierter … Das sind Sachen, da müsste man sich im Detail streiten.
HG: Das Wichtigste aber ist seine Denkweise, die ausschließlich auf die Analyse der sozialen Bezüge von Männern gerichtet. ist. Wo bleibt der ganze Reproduktions- und Arbeitssektor der Frauen? … fällt völlig weg! Wo bleibt die Geschichte der Frauen? … ist nicht drinnen!
AvP: Aber es ist doch nicht von der Lehre her ausgeschlossen!
HG: Es ist faktisch ausgeschlossen.
AvP: Das muß nicht … Eine materialistische Herangehensweise im Sinne von Marx schließt das überhaupt nicht aus – im Gegenteil.
HG: Es ist theoretisch nicht ausgeschlossen, aber es ist nicht getan worden. Und die Folge davon ist der Aufbau der sozialistischen Staaten. Das siehst du, da sind die Frauenprobleme mitnichten gelöst worden.
CS: Aber hängt das nicht auch von der historischen Situation ab? Wenn ich mir vorstelle – ganz spekulativ gedacht –, wir würden in einigen Jahren die sozialistische Revolution haben, dann würde es bei uns sicher ganz anders aussehen als z.B. in der DDR, weil doch der Stand unserer Frauenbewegung und auch der bewussten Frauen ein ganz anderer ist.
HG: Ich weiß nur nicht, wie weit in den sozialistischen Revolutionen die Frauenbewegung dann wieder unterdrückt würde. In Russland wird jeder feministische Ansatz absolut unterdrückt, weil man dort von der Ideologie ausgeht, dass mit der Auflösung der Klassengegensätze jedes Frauenproblem gelöst ist; da ist keine Kritik möglich. Es ist in der Theorie nicht drin, dass die Frauen die marxistische Analyse patriarchal hinterfragen, dass mit der Analyse der Klassengegensätze und des Privateigentums noch nicht alles geleistet worden ist.
Ich möchte den Gedanken als Anregung hier einfügen, dass die marxistische Klassenanalyse nämlich im Grunde erst ab einer bestimmten historischen Entwicklungsstufe passt, erst ab der antiken Sklavenhaltergesellschaft. Ab da untersucht Marx; ab da passt’s. Und das ist eine typisch klassisch patriarchale Gesellschaft. Während, wenn du dir matriarchale Gesellschaften, die Gentilgesellschaften anschaust, da passt die Klassenanalyse überhaupt nicht. Und darum ist es mir begreiflich, warum Marx bei seinem Denkapparat die Analyse der Nicht-Klassengesellschaften gar nicht in den Blick bekommt. Es ist eben unsere historische Aufgabe heute, das zu überschreiten, die Analyse nochmal gründlicher zu machen, nochmal mehr in die Geschichte zurückzugehen, da wo eben mangels Wissen oder auch Kenntnisse über solche Gesellschaften die Analyse noch nicht möglich war. Ich will nicht sagen, dass Marx, wenn heute leben würde, das auslassen würde. Heute würde er es vielleicht tun.
AvP: Darauf kam es mir an.
HG. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn auch von Marxisten die Patriarchatskritik weitergetrieben wird; aber sie wird faktisch nicht. In den Ostblockstaaten mag das Problem darin liegen, dass sie ihre Gesellschaft noch immer nicht als Patriarchat begreifen. Das wäre ja eine immanente Kritik, die dort sehr schwierig ist.
BD: Aber das ist ja auch eine lange Entwicklung, bevor man seine Gesellschaft als patriarchal begreift. Alles in unserer Sozialisation arbeitet doch darauf hin, dass das verwischt wird, dass das nicht existiert.
HG: Ja, wie ich eingangs schon sagte, waren die Begriffe „Patriarchat“ und „Matriarchat“ bei uns vor 10 Jahren noch völlig tabu; die sind erst heute wieder salonfähig. Und in dieser Hinsicht muss das Bewusstsein, dass sozialistische Staaten ihre patriarchalen Elemente und Strukturen noch immer haben, auch erst langsam durchdringen. Vielleicht gibt es dann auch mal zureichendere Analysen.
Zweifellos gibt es ja marxistische Theoretiker, die sehr für die Frauen mitdenken; aber den Rahmen des Systems und der praktischen Probleme setzen immer noch die Männer. Für mich ändert sich grundlegend erst dann etwas, wenn den Frauen nicht gesagt wird: hier könnt ihr euch gleichberechtigt an der Ökonomie beteiligen, eure Kinderkrippen usw.; sondern wenn Frauen mal in den Stand gesetzt werden, den Rahmen der Gesellschaft mitzubestimmen. Solange das nicht der Fall ist, werden die alten Sozialstrukturen unausrottbar bleiben, werden sich die Frauen überlegen, warum sie ihre Kinder im Kinderhort abliefern sollen, wenn sie noch nicht einmal den Rahmen der Erziehung bestimmen können.
Matriarchale Gesellschaften sind nun mal die, wo Frauen bestimmend den Rahmen der Gesellschaft prägen, nicht allein, aber bestimmend. Und solange das nicht gegeben ist, hast du Patriarchate. Da muss man ihnen den Raum einräumen, überhaupt das framework, das Gesamte der Gesellschaft, theoretisch und praktisch mitzubestimmen.
„Ganzheitlichkeit“ contra „Basis-Überbau“
BD: Du hast es eigentlich gerade selber angesprochen. Wenn eine Frau mitbestimmen würde, dann wäre für sie nicht das Problem: wie finanziere ich eine Krippe, wie gehe ich arbeiten? Sie würde ganzheitlicher denken, sie würde fragen: Wie kann ich gesellschaftlich tätig sein, ohne mich von meinem Kind zu trennen? Wie müssen die gesellschaftlichen Bedingungen sein, dass diese Trennung eben nicht vollzogen werden muss?
HG: So sehe ich es auch. Eine Frau würde sagen: mich interessiert doch nicht nur der ökonomische Faktor, sondern der ökonomische, der seelische, der spirituelle und der geistige zugleich. Das ist eine andere Denkweise.
Erst wenn wir wirklich gleich sind, politisch und ökonomisch, dann setzt sich diese Perspektive durch. Auch wenn wir die juristische Gleichberechtigung haben und in der marxistischen Theorie auch die ökonomische Gleichberechtigung der Frau, sie wird – aus welchen Gründen auch immer – nicht realisiert. Wenn man sich die Spitze der Hierarchien und der Institutionen anschaut, da sind irgendwelche retardierenden Mechanismen, die unbewusst patriarchal sind bei diesen Männern.
Trotzdem, ich habe in keinem Punkt bestritten, dass die Bestrebungen marxistischer Männer oder auch progressiver bürgerlicher Männer notwendig sind, um überhaupt erst mal eine Gleichheit der Chancen für Frauen herzustellen. Aber bei allen progressiven Tendenzen – die Analyse geht noch nicht weit genug. Deswegen bezeichne ich – das ist vielleicht eine kuriose Bezeichnung – die marxistischen Staaten als „patriarchal-reformistisch“. Sie sind, was das patriarchale Element betrifft, keineswegs revolutionär, sondern reformistisch; wenn dir das was sagt, dieses Wort. Mir hat‘s zur Klärung was genützt.
AvP: Zwischen Revolution und Reform muss man ja nicht so absolut trennen.
HG: Also, ob du eine patriarchale Gesellschaftsordnung und Denkweise hast oder eine andere, das ist schon ein ganz gewaltiger Sprung. Das sage ich nicht nur von meiner Theorie her, sondern auch von meiner praktischen Erfahrung. Wie lange ich selbst mit anderen Frauen darum ringe, die ganze patriarchale Infiltration und Erziehung, die wir in uns haben, herauszubekommen!
In meinem ganz persönlichen Leben erlebe ich jeden Schritt wirklich als revolutionär und sehr verändernd. Versucht z.B. mal, nicht dualistisch zu denken, sich wirklich so zu verhalten, also – ich sage das jetzt so als Schlagwort: es ist wahnsinnig schwierig. Da sehe ich nämlich, in wie vielen Gewohnheiten wir stecken, die in uns unbewusst viel stärker sind, als wir meinen.
US: Gerade bei den Prozessen der Selbstbewusstwerdung passieren wahnsinnig viel Rückschläge, permanent. Aber ich denke, genauso wie das Automatismen sind, die man mit sich herumschleppt, muss auch das Neue sich zum Automatismus entwickeln; und bis sich das vom Bewusstsein im Verhalten widerspiegelt, ist noch ein weiter Schritt.
HG: Ja, deswegen ist auch der Weg, den die Frauenbewegung am Anfang nahm, der conscious raising groups, also der Gruppen, die Bewusstsein verändern, so enorm wichtig; denn diese Art von Revolution beginnt wirklich beim Individuum, beim Bewusstsein. Sonst fallen wir wieder, selbst wenn wir das Beste wollen und beabsichtigen, in unbewusste patriarchale Mechanismen zurück, Frauen wie Männer.
US: Die bilden ein unheimliches Kontrollsystem, auch sich selbst gegenüber.
HG: Das geht bis in die Träume, bis in die unbewussten Visionen, bis in die Gefühle.
GS: Was mir dabei sehr schwer fällt, ist, dass dieser Prozess ja zu einem sehr großen Teil über die wissenschaftliche Aneignung läuft, über eine Denkform, gegen die ich mich ja zunächst einmal stelle.
HG: Diese Brüche haben wir, weil wir uns in dieser Kultur bewegen und deren Sprache brauchen, um uns verständlich zu machen. Wir leben ja nicht in einer heilen, utopischen Gesellschaft.
US: Auch die Form von Wahrnehmung, die sich ja auch verändert. Du nimmst zunächst ja mal das wahr, was du kennst, und mit dem du in deinem Kulturkreis verwachsen bist, wovon du einen Begriff hast. Von dem Moment an, wo dein Bewusstsein sich ändert, verändert sich auch deine Sensibilisierung und du nimmst die Dinge anders wahr,
HG: Ich möchte es auch nochmal von der Seite des Unbewussten her betonen. Das ist eben ein Punkt, wo selbst die progressivsten Denker plötzlich ihr patriarchales Unbewusstes hervorkehren. Die Beziehung zwischen Männer und Frauen ist sehr stark von seelischen, auch von erotischen Faktoren geprägt, die tief in unser Unbewusstes reichen. Und da schnappt immer wieder die Falle zu, wenn diese Bewusstwerdungsprozesse nicht geschafft werden. Das ist etwas anderes, als alles durch Ökonomie zu lösen; das sind andere Elemente, viel tiefer greifend.
US: Ich denke, gerade für Frauen ist diese Form der Abhängigkeit wesentlich schwieriger zu lösen als die ökonomische.
HG: Solche Erscheinungsformen hat man bei uns ebenso wie in den sozialistischen Ländern, wo die Frauen im günstigsten Fall relativ unabhängig sind – und dann bilden sie wieder ihre Kleinfamilie. Nicht mehr als Wirtschaftsgrundlage, aber psychisch werden dann die ganz alten patriarchalen Muster wiederholt. Ich meine auch, die marxistische Analyse hat an diesem Punkt das Problem, dass die psychische Innenseite der Menschen kaum ins Blickfeld kommt, es ist mehr die gesellschaftstheoretische Außenseite; aber das ganze Feld der psychischen Innenseite und ihre Verschränkung mit der ökonomischen Außenseite bleibt unklar.
AvP: Sag jetzt aber nicht: „das Ökonomische ist das Unwichtige“.
HG: Ich sage nicht, das eine ist wichtig, das andere ist unwichtig; das eine steht oben, das andere unten. Das wäre schon wieder ein Hierarchisieren. Ich habe lediglich gesagt, der psychologische Bereich, der Innenbereich, fehlt in der marxistischen Analyse. Das wertet sie nicht ab; aber es fehlt ihr der Bereich, um den Menschen wirklich ganz zu erfassen.
US: Bei einem noch so aufgeklärten Mann laufen Sachen ab, die sind über die Begrifflichkeit gar nicht zu lösen.
AvP: Ich find‘s schade – jetzt mal etwas polemisch gesagt –, wenn eine gewisse Elite sich über Fragen des Innenlebens unterhält, während andere schauen müssen, dass sie überhaupt am Leben bleiben. Wenn wir in die Welt hineinschauen, dann müssen wir doch zum Ergebnis kommen, dass Frauen hier in Westeuropa oder Nordamerika eine gewisse Elite bilden. Deswegen mein Beharren darauf, dass die ökonomische Sicherung erst mal vorhanden sein muss. Würdest du nicht meinen, dass insofern eine Hierarchie nötig ist? Ohne eine ökonomische Grundlegung und Sicherung ist es eben sehr schwer, sich auch psychisch zu befreien.
GS: Aber warum nicht gleichzeitig?
US: Du hast schon wieder eine Hierarchie und Rangordnung drinnen!
HG: Was ich vorhin sagte mit dem ganzheitlichen Denken, das ist kein Plakat, sondern eine andere Einstellung, mit den Dingen umzugehen. Ich sage nicht, die Ökonomie ist die Basis, und der ganze Rest ist Überbau. Das ist schon wieder ein hierarchisches Denken, von dem ich nicht ausgehe. Was du sagst, dass, wenn Menschen nichts zu essen haben, sie sterben, darüber brauchen wir doch gar nicht zu diskutieren. Aber dass die Menschen eine Innenseite haben und dauernd auf diese Innenseite reagieren, ist genauso wichtig. Das sehe ich nicht hierarchisch, sondern verschränkt. Es ist nicht die Frage von Psychologie als Teil des Überbaus, sondern dass du wirklich den Menschen, so wie er ist, elementar nimmst. Er hat ja nicht nur Essbedürfnisse; er hat eine ganze Reihe anderer, die dauernd ineinander übergreifen.
Wenn in Amerika und Deutschland die Frauen damit begonnen haben, conscious raising zu machen, dann war das oft eine Art von elementarer Notwendigkeit. Das waren keine elitären Zirkel, sondern das hat besonders den Frauen geholfen, die fast auf der niedrigsten Stufe standen, nämlich den geprügelten Frauen, die in die Frauenhäuser kamen. Mit denen haben Frauen gearbeitet und gearbeitet, damit sie, nachdem sie sich in den Frauenhäusern erholt hatten, nicht wieder in dieselben verbogenen Strukturen zurückkehren, wo sie wieder als Sklavin ihres Mannes, sei es der Arbeiter oder der Bürger, sich prügeln lassen mussten. Damit sie überhaupt erst einen Schritt zu ihrer ökonomischen Selbständigkeit tun konnten, war es für sie elementar wichtig, dass sie erst mal ein Bewusstsein von dem bekommen, was ihnen dauernd passiert ist. Die hielten das für naturgewollt oder gottgegeben – oder gar für richtig –, bis ihnen klar wurde, dass die Familienform, in der sie steckten, absurd ist. Dann hatten sie den Mut zu sagen: jetzt versuche ich, mir mein Geld selber zu verdienen. Es ist wirklich nicht das Entweder – Oder.
US: Aber es ist doch zu beobachten, dass dies Bewusstsein sich regressiv zu entwickeln beginnt. Das war schon mal stärker. Mittlerweile gibt es wieder diese Tendenzen zur Sicherheit; dieses Zurück zu einer bestimmten Weiblichkeit ist gerade wieder unheimlich am Aufflammen.
HG: Welche Form von Weiblichkeit? Die alten Familienformen?
US: Ja, genau; wenn ich beobachte, …
HG: … das wird ja auch politisch gefördert: die „neue Mütterlichkeit“, die „sanfte Macht der Familie“. Das hängt natürlich auch mit der desolaten Arbeitssituation zusammen, wo die Frauen die ersten sind, die die Stellen verlieren. Dann wird ihnen wieder Heim, Haus und Kinder angedient, und das auch noch als – „sanfte Macht“! Ich meine, das ist ein uralter politischer Trick, der ist so neu nicht.
AvP: Aber wenn dieser Trick mal abgeschafft wäre und ökonomische Gleichberechtigung bestünde, …
HG: … das wäre ein riesiger Fortschritt, da haben wir keinen Dissens. Ich frage mich jedoch: wie schön die Theorie auch ist, wie weit stimmt sie denn in der Praxis mit der ökonomischen Gleichstellung der Frauen überein? Wenn die Frauen immer nur ‚leicht‘ – wenn‘s nur leicht ist – im Nachteil mit ihren ökonomischen Möglichkeiten gegenüber den Männern sind, dann kann ich mir das nur aus unbewusst patriarchalen Denkweisen erklären, die die Männer haben und immer wieder durchführen. Drum sage ich ja: im Grunde ändert sich nichts – außer die Frauen bestimmen den Rahmen der Gesellschaft ganz stark mit. Sonst ändert sich da nichts.