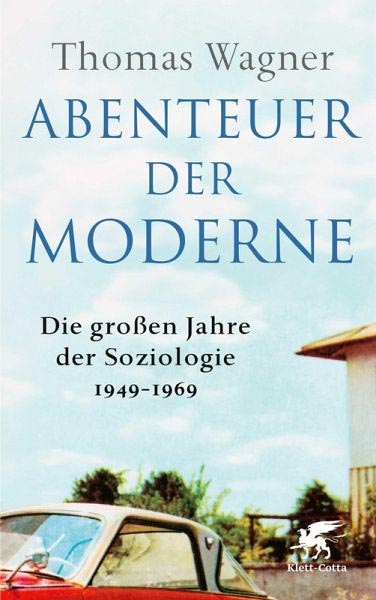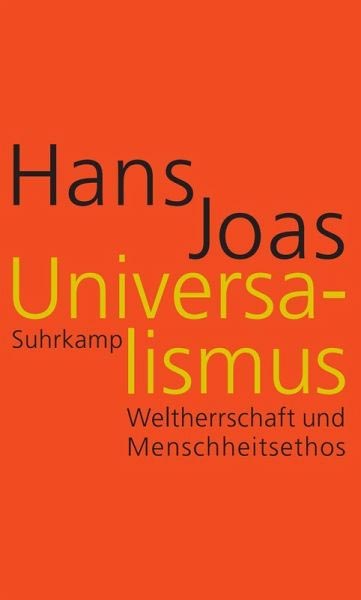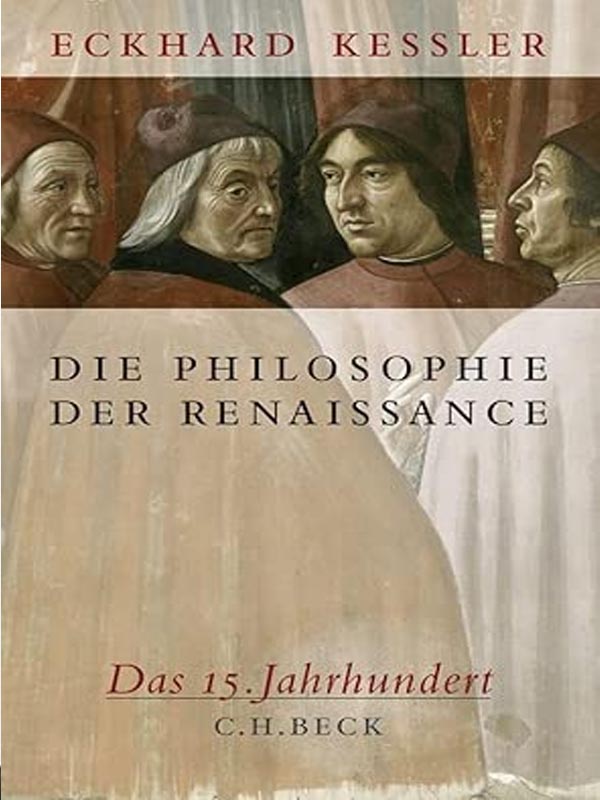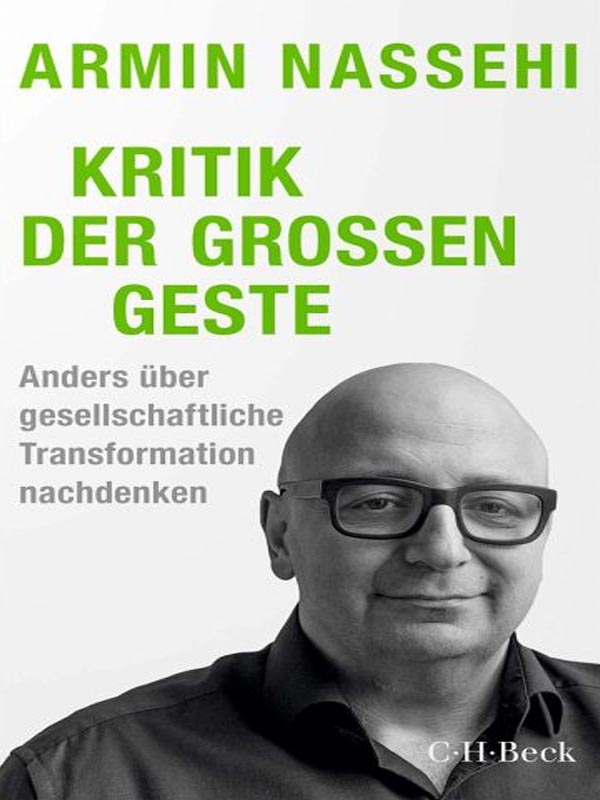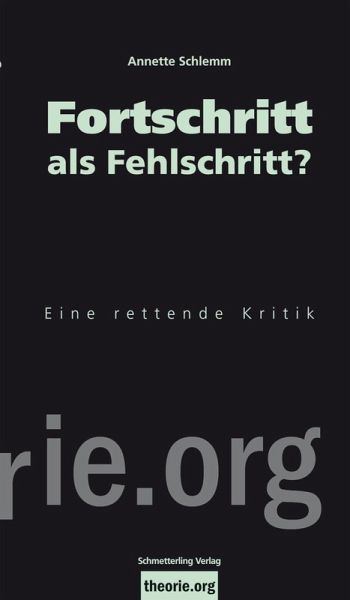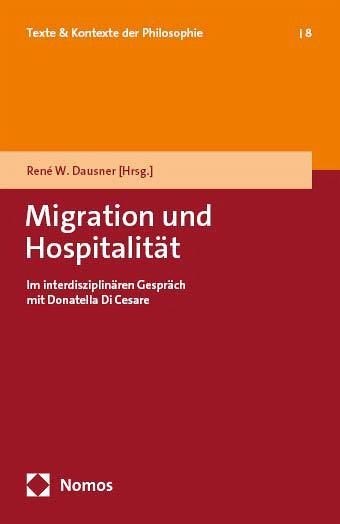Carlos Ulises Moulines (* 1946 in Caracas, Venezuela) studierte in Barcelona Physik, Philosophie und Psychologie und promovierte 1975 in Logik und Wissenschaftstheorie. Von 1993 bis 2012 war er Ordinarius für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie an der Universität München und Vorsitzender des Instituts. Er ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und war von 1997 bis 2000 Präsident der Gesellschaft für Analytische Philosophie.
Das Angebot des Widerspruch, eine kurze Selbstbiographie für die Rubrik „Münchner Philosophie“ zu schreiben, nehme ich gerne wahr. Es stellt eine willkommene Gelegenheit dar, mir Gedanken darüber zu machen, wieso ich Philosoph, dazu noch „Münchner Philosoph“, geworden bin, und die Ergebnisse all denen mitzuteilen, die erfahren möchten, was zur Fauna der Münchner Philosophie gehört.
Als meine Eltern beschlossen, mir als Vornamen die hispanisierte Version des altgriechischen „Odysseus“ zu geben, ahnten sie wohl nicht, wie sehr sie dadurch meinen Lebenslauf vorbestimmten. Inzwischen bin ich zu der festen Überzeugung gelangt, dass im lateinischen Spruch „nomen est omen“ ein Körnchen Wahrheit steckt – auch wenn Sie, liebe LeserInnen, dies als einen des Philosophen unwürdigen Aberglauben abtun sollten! Das ständige Herumvagabundieren des Helden von Homer habe ich, teils gewollt, teils ungewollt, nach Kräften nachgeahmt, und zwar nicht nur in geographischer, sondern auch in geistiger Hinsicht.
Ich bin in Venezuela geboren, wohin die Wirren des spanischen Bürgerkriegs und des Zweiten Weltkriegs meine Eltern verschlagen hatten. Sie waren Anhänger der spanischen Republik und mussten aufgrund von Francos Sieg zunächst nach Frankreich fliehen. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen wurden sie als „Fremdarbeiter“ nach Deutschland verschleppt. Abgesehen von den Phosphor-Bomben und von einem (verhältnismäßig kurzen) Aufenthalt meines Vaters in den Kerkern der Gestapo, war ihre Zeit in Nazi-Deutschland nicht so schlimm, wie sie zunächst befürchtet hatten. Als der Krieg zu Ende ging, gelang es ihnen unter abenteuerlichen Umständen, nach Venezuela auszuwandern.
Die deutsche Erfahrung meiner Eltern sollte sich als entscheidend für meine spätere Laufbahn erweisen, und dies aus zweierlei Gründen: Erstens haben sie mir seit frühester Kindheit eingeprägt, dass Deutschland nach wie vor, trotz Hitler & Co., eine grosse Kulturnation sei; und zweitens ließen sie mich öfters, da sie gute Freundschaften in Deutschland geknüpft hatten, die Ferien hier verbringen, wo ich zwar nie systematisch, wohl aber irgendwie funktional mit den Rudimenten der Sprache Brechts und mit der Komplexität der deutschen Seele einigermaßen vertraut wurde.
In Caracas machte mein Vater, der eine Ausbildung als chemischer Ingenieur hatte, eine wissenschaftlich-technische Buchhandlung auf, die sehr erfolgreich wurde. Jeden Tag nach dem Schulunterricht half ich ihm ein bisschen als Mann bzw. Kind für alles, und war notgedrungen konfrontiert mit Titeln der Art von „Partial Differential Equations“, „Thermodynamics of Irreversible Processes“ oder „Dynamics of Viscous Fluids“. Ich hatte zwar nicht die leiseste Ahnung, was sich hinter diesen Bezeichnungen verbergen konnte, doch beeindruckten sie mich sehr und blieben im Unterbewusstsein haften, gekoppelt mit der Mahnung: „Irgendwann musst du mal herausfinden, was dahintersteckt“. Unter den regelmässigen Kunden der Buchhandlung befanden sich viele Dozenten der naturwissenschaftlichen Fakultäten oder der Technischen Hochschule, die oft mit meinem Vater ins Gespräch kamen und Namen wie „Einstein“ oder „Darwin“, bzw. Wörter wie „Quanten“ und „Relativitätstheorie“ fallen ließen. Auch diese geheimnisumwobenen Ausdrücke regten meine Phantasie an.
Die Bücher, die ich zuhause in der umfangreichen, fünfsprachigen Bibliothek vorfand, waren von ganz anderer Art als die der Buchhandlung: vor allem politische Essays, Studien zur neueren Geschichte Lateinamerikas, Spaniens und Europas, viele Klassiker der Weltliteratur – und praktisch alle gesellschaftskritischen Schriften eines gewissen Bertrand Russell. Meine Eltern waren begeisterte Russell-Leser. Ich blätterte ab und zu mal rein, und nahm mir vor, irgendwann später Russells Essays genauer zu lesen. Aber damals zog ich selbstverständlich die Romane von Jules Verne oder die Erzählungen von Edgar Allan Poe bei weitem vor.
Angesichts der zunehmend instabilen Lage in Venezuela schickten mich meine Eltern, als ich kaum 13 Jahre alt war, zum Besuch des Gymnasiums nach Katalonien, zunächst in eine Kleinstadt zu einer Tante, dann nach Barcelona, wo ich das Abitur machte. Das war eine Zeit, an die ich mich heute noch mit Abscheu erinnere. Das Spanien der 60er Jahre litt noch unter einer grässlichen Diktatur. Die Oppositionellen wurden zwar nicht mehr so oft erschossen wie in den 40er und 50er Jahren – das war auch nicht mehr nötig, und zudem übte das Ausland einen gewissen Druck aufs Regime aus –, aber die bleierne, erstickende Atmosphäre war überall zu spüren: In den Polizeirevieren wurde systematisch gefoltert, Telefone wurden abgehört, nicht-gläubige Schüler wurden gezwungen, an der Schulmesse teilzunehmen, der öffentliche Gebrauch der Minderheiten-Sprachen, wie etwa des Katalanischen, war strikt verboten, viele, auch eher harmlose Bücher, wie etwa über Evolutionstheorie oder Sexualkunde, waren einfach nicht zu bekommen, usw. Und vor allem – man musste ständig aufpassen, was man sagte, und vor wem man es sagte.
Diese Erfahrungen waren schlimm, aber auch prägend. Seitdem weiß ich ganz genau, was für einen unermesslichen Wert es bedeutet, in einer echt freiheitlichen Gesellschaft zu leben. Es bedeutet nämlich, dass der Staat uns alle gefälligst in Ruhe lassen sollte, was unsere Meinungen und Überzeugungen anbelangt. Diese an sich banale Selbstverständlichkeit ist nach wie vor alles andere als gesichert. Nicht nur im heutigen, als so dynamisch und demokratisch gepriesenen Spanien gibt es immer noch eine beträchtliche Anzahl von Dummköpfen, die innerlich (oder sogar öffentlich) dem Franco-Regime nachtrauern. Auch in den älteren westlichen Demokratien findet allmählich und heimtückisch ein Rückgang in Richtung Reglementierung der Meinungsvielfalt statt, und zwar nicht nur in George Bushs Reich, sondern auch in Europa. Wir alle, die jüngere Generation aber ganz besonders, sollten auf der Hut sein. Es versteht sich von selbst, dass jeder Einschnitt in die Meinungsfreiheit, so klein er auch erscheinen mag, gerade für die Philosophie, aber nicht nur für sie, tödliches Gift darstellt.
Nach dem Abitur beschloss ich zunächst, mein Studium der Physik an der Universität Barcelona zu beginnen. Die offizielle Motivation war, dass ich wissen wollte, wie die Welt beschaffen ist. Der heimliche Grund aber war, dass ich endlich herausfinden wollte, was sich hinter den geheimnisvollen Titeln in der väterlichen Buchhandlung versteckte. Allerdings hatte ich damals schon auch damit angefangen, zahlreiche philosophische Texte verschiedenster Provenienz zu lesen. Ich hatte drei Lieblingsautoren. Einer war gewiss, schon aus familiären Gründen, Russell, hauptsächlich wegen seiner mathematikphilosophischen und erkenntnistheoretischen Werke, die mich sehr interessierten. Ein zweiter war der Tractatus-Wittgenstein, von dessen Existenz ich durch Russell erfahren hatte. Tag für Tag, Woche für Woche ackerte ich mich zusammen mit einem Freund durch jeden einzelnen Absatz dieses geheimnisvollen Werks durch. Wir verstanden wenig, aber fanden es sehr spannend. Die zwei Grundpfeiler von Wittgensteins Philosophie, die er im Vorwort explizit angibt: „Alles, was sich sagen lässt, lässt sich auch klar sagen“ und „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“, empfand ich als absolut richtungsweisend, bedauerte allerdings, dass der Autor selbst offenbar nicht imstande war, sich daran zu halten. Trotz meiner eher kritischen Einstellung gegenüber Wittgensteins Stil des Philosophierens bin ich immer wieder auf Wittgenstein zurückgekommen. Jahre später sollte ich die Philosophischen Untersuchungen und Zettel ins Spanische übertragen.
Der dritte Lieblingsautor jener Zeit – und das wird manch einen, der meine philosophische Laufbahn kennt, überraschen – war Heidegger, insbesondere seine späteren Schriften. Ich war sogar davon überzeugt, dass ich sie verstand. Von Heideggers Zauberkunststücken mit der altgriechischen und der deutschen Sprache war ich regelrecht fasziniert. Während meines Physikstudiums, als ich mich durch die öden Differentialgleichungen gelangweilt fühlte, griff ich immer wieder zu den Holzwegen oder zu Was heisst Denken und bekam dabei das Gefühl, dass sich mir eine magische, erfrischende Welt öffnete. Doch bei der Lektüre von Heideggers Vorlesungen über Metaphysik stieß ich eines Tages auf die berüchtigte Stelle über „die innere Wahrheit der nationalsozialistischen Bewegung“. Es war ein regelrechter Schock. Die darauffolgende Entdeckung von Heideggers Rektoratsrede gab mir den Rest. Die Heidegger-Welle war für mich nun endgültig vorbei.
Heute weiß ich, dass dies ein voreiliger, philosophisch nicht gut fundierter Schluss war. Auch Frege war Antisemit – was jedoch seine logische Konstruktion der natürlichen Zahlen keineswegs falsch oder uninteressant macht. In jener Zeit aber wurde für mich durch diese Erfahrung klar, welche Art von Philosophie ich nicht ernst nehmen wollte; nicht klar dagegen war, welche ich ernst nehmen sollte, und ob ich mich überhaupt mit Philosophie systematisch beschäftigen wollte.
In dieser existenziell problematischen Lage half mir das Physik-Studium selbst zur endgültigen Entscheidung. Ich stand diesem zunehmend kritisch gegenüber. Nicht, weil mich der Stoff nicht interessiert hätte. Vielmehr ging es um die völlig kritiklose, dogmatische Art und Weise, wie er übermittelt wurde. Ich hatte das Gefühl, wie in einer erbarmungslos disziplinierten Armee, nur alles schlucken zu dürfen, was die Dozenten erzählten, und zur Anwendung fauler Tricks gedrillt zu werden, um Gleichungen zu lösen, oder um zu bewirken, dass unsere Laborversuche genau das zeigten, was ohnehin zu erwarten war. Jahre später las ich Thomas Kuhns Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, insbesondere das, was er als die „normale Wissenschaft“ und das „puzzle-solving“ beschreibt, und ich erinnerte mich: „Tja! Genauso war es bei meinem Physik-Studium!“. Auch demgegenüber bin ich heute klüger geworden und weiss, dass gerade diese brutal-dogmatische Art, den angehenden Physikern die Grundlagen des Fachs einzuhämmern, eine wesentliche Voraussetzung für die unglaubliche Erfolgsstory der Physik ausmacht. Damals sah ich das aber nicht ein. Ein anekdotischer Vorfall brachte dann das Fass endgültig zum Überlaufen. In der Mechanik-Vorlesung erzählte uns der Dozent, dass das sog. Zweite Prinzip Newtons den absolut zentralen Grundsatz der Mechanik darstelle, da es die Definition des Kraftbegriffs beinhalte. Ich hob die Hand und fragte, wieso dieser Satz so fundamental sei, wenn er eine Definition darstellt; denn eine Definition ist nur eine sprachliche Konvention über den Gebrauch eines Terms, die keine neuen Erkenntnisse liefert. Der Dozent zeigte sich durch meinen Einspruch sehr verärgert und erwiderte, wer solche blödsinnigen Fragen stelle, solle gleich zur Philosophie übergehen.
Was ich dann auch tat. Ich begann mein formelles Studium der Philosophie. Das Physik-Studium habe ich allerdings nicht ganz aufgegeben, sondern nur etwas verlangsamt. Ich studierte beide Fächer parallel, um mich u. a. der lästigen Frage um Newtons Zweites Prinzip zu entledigen. Später dann sollte ich erfahren, dass die Frage nach dem logisch-methodologischen Status dieses Prinzips in der Tat keineswegs trivial ist, und dass bedeutende Physiker und Wissenschaftstheoretiker sich damit seit Ernst Machs Zeiten herumgeschlagen haben. Ich selber meine inzwischen, eine Lösung dazu gefunden zu haben, die ich in einigen meiner Schriften dargelegt habe.
So bin ich also dank der schroffen Zurechtweisung meines Mechanik-Lehrers zum Philosophen und Wissenschaftstheoretiker geworden.
In der barcelonesischen Fakultät für Philosophie hatte ich das Glück, durch einen frischgebackenen Schüler von Hans Hermes, Jesús Mosterín, eine gute Ausbildung in der modernen Logik und der axiomatischen Mengenlehre zu bekommen, was im damaligen Spanien keineswegs selbstverständlich war. Es war aber nicht so sehr die „reine“ Logik, die mich anspornte, sondern die Möglichkeiten ihrer Anwendungen auf erkenntnistheoretische und wissenschaftstheoretische Probleme. Nun fiel mir mehr oder wenig zufällig Carnaps Logischer Aufbau der Welt in die Hände. Es war ein Aha-Erlebnis. Hier ist endlich einer, dachte ich, der Russells „Maxime des wissenschaftlichen Philosophierens“ (nämlich intuitive Schlüsse durch logische Konstruktionen, auch im Fall der empirischen Erkenntnis, zu ersetzen) wirklich in die Tat umsetzt. Meine Magisterarbeit widmete ich in der Hauptsache der Analyse und Revision von Carnaps „Konstitutionssystem“. In erweiterter Form erschien meine Untersuchung ein paar Jahre später als Buch. Seitdem hat mich das Interesse an Carnaps hochkomplexem Werk und an den Möglichkeiten, sein Programm irgendwie weiterzuführen, nie ganz verlassen, und nach dem erwähnten Buch habe ich dazu noch einige Aufsätze sowohl ideengeschichtlicher als auch systematischer Art veröffentlicht.
In dieser Zeit bekam ich ein ernstes Problem mit den spanischen Behörden. Bei einer Demonstration gegen das Franco-Regime wurde ich verhaftet. Da ich einen venezolanischen Pass bei mir hatte, wurde ich nicht – wie sonst üblich – verprügelt und eingekerkert, dafür aber des Landes verwiesen. Nun war aber das damalige Spanien zwar ein Polizeistaat, aber kein perfekter: Francos Schergen haben es nämlich versäumt, sowohl der Universitätsverwaltung wie auch ihren Konsulaten in Europa mitzuteilen, dass ich ein unerwünschter Ausländer war. So fuhr ich mal nach Frankreich, mal nach Italien, mal nach England, um mir dort beim Konsulat ein Touristen-Visum für sechs Monate zu besorgen, womit ich wieder nach Barcelona kam, mich für die Kurse einschrieb und weiterstudierte. Ich wurde sozusagen zu einem Untergrund-Studenten. Dieses Katz-und-Maus-Spiel dauerte drei Jahre. Natürlich war es sehr stressig, aber ich habe es doch bis zum Magisterabschluss (für den ich ironischerweise einen Preis bekam) geschafft.
Mir war aber klar, dass dieses Spiel nicht ewig lange dauern konnte, und dass ich in Spanien sowieso keine Chance hatte. Die Rettung kam quasi in letzter Minute durch ein DAAD-Promotionsstipendium, was meine in Ansätzen schon vorhandene Germanophilie erheblich verstärkte. Im Wintersemester 1970/71 „flüchtete“ich nach München, um im damals von Wolfgang Stegmüller geleiteten „Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie“ zu promovieren, was vier Jahre später auch geschah. Als ich nach München kam, betrachtete ich mich selber als „Carnapianer“ und dachte, nun käme ich in die Obhut des bedeutendsten Carnapianers Europas. Doch damals war Stegmüller schon in eine – wie er selber später sagte – „tiefe geistige Krise“ geraten. Teilweise durch die Lektüre Kuhns, aber auch aus anderen Überlegungen heraus, sah er nun unüberwindliche Schwierigkeiten in der herkömmlichen Auffassung der Struktur und Funktionsweise der empirischen Wissenschaften. Als Reaktion darauf, und gerade als ich mein Promotionsstudium in München begann, fingen Stegmüller und einige seiner Schüler sich intensiv mit dem neuartigen, vielversprechenden Ansatz von Joseph D. Sneed zu beschäftigen.
Stegmüller leitete damals ein DFG-Projekt zu dieser Thematik, an dem ich als Mitarbeiter mitwirken durfte. In diesem Zusammenhang lernte ich auch Sneed, der als Gastprofessor nach München kam, und Wolfgang Balzer, ebenfalls ein Doktorand Stegmüllers, kennen. Mit ihnen (und mit Stegmüller bis zu seinem frühen Tod) verbindet mich seitdem eine dauerhafte Freundschaft und eine enge, langjährige Zusammenarbeit. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die wissenschaftstheoretische Forschungsrichtung, die seit Ende der 70er Jahre als „strukturalistische Wissenschaftskonzeption“ allgemein bekannt wurde, und die später in dem von Balzer, Sneed und mir verfassten Werk An Architectonic for Science kulminieren sollte.
Nach meiner Promotion mit einer Arbeit „Zur logischen Rekonstruktion der Thermodynamik“ wurde ich 1975 Assistent bei Stegmüller. Ich war im Prinzip entschlossen, meine akademische Laufbahn in Deutschland fortzusetzen. Es gab aber schon wieder ein Problem: Die Ausländerbehörde an der Ettstrasse sah nicht ein, dass ein „Dritte-Weltler“, der bloss mit einem Stipendium hierher gekommen war, auf unbestimmte Zeit in Deutschland bleiben durfte. Trotz Stegmüllers ausserordentlich freundlichem Einsatz (er hat sogar den damaligen Rektor Professor Lobkowicz dazu bewegt, ein Wort für mich einzulegen) wurden die Beamten an der Ettstrasse nicht einsichtiger, und ich musste jederzeit damit rechnen, manu militari zum Flughafen gebracht zu werden. Irgendwie kam mir die Situation bekannt vor. Doch auch diesmal kam die Rettung in letzter Sekunde. Aufgrund ziemlich zufälliger Kontakte erhielt ich das Angebot einer Dauerstelle am „Institut für philosophische Forschung“ der Nationalen Universität Mexikos, eines Landes, das ich überhaupt nicht kannte, das mir aber eine gute Zuflucht anbot. Also habe ich die Koffer gepackt.
Die Arbeitsbedingungen in Mexiko erwiesen sich als optimal. Ich musste nur zwei Stunden wöchentlich unterrichten, und den Rest konnte ich voll der Forschung widmen, zudem mit guten Publikationsmöglichkeiten. Im mexikanischen Institut habe ich natürlich meine Arbeiten innerhalb des strukturalistischen Ansatzes weitergeführt, mich aber auch zunehmend mit allgemein erkenntnistheoretischen, ontologischen und wissenschaftshistorischen Themen befasst. (In München hatte ich schon Wissenschaftsgeschichte als Nebenfach im Institut am Deutschen Museum studiert.) Seitdem sind auch sie Schwerpunkte meiner Forschung geblieben.
Während meiner mexikanischen Zeit bekam ich von der „University of California at Santa Cruz“ für ein Jahr eine Einladung als „Visiting Professor“. Es gab viele gute Dinge dort: eine entzückende Landschaft, optimale Arbeitsbedingungen (besonders in den Bibliotheken) und die Nähe zu Stanford: Jeden Freitag nachmittags fuhr ich zum Seminar von Patrick Suppes, was meine Arbeit beträchtlich förderte. Dennoch, und obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte, länger zu bleiben und meine akademische Laufbahn in den Vereinigten Staaten aufzubauen, funktionierte die „Chemie“ zwischen meiner Person und meiner US-amerikanischen Umwelt nicht so ganz richtig, so dass ich beschloss, nach Mexiko zurückzukehren. Allerdings ließ ich mir damit noch etwas Zeit: Die Rückkehr von Kalifornien nach Mexiko-Stadt dauerte – auf dem Umweg über die Stationen der Universität Campinas in Brasilien und des Zentrums für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld – ein Jahr.
Zurück im mexikanischen Institut führte ich meine Forschungstätigkeit in Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte, Erkenntnistheorie, Ontologie und verwandten Gebieten in sehr produktiver Weise fort. Alles in allem habe ich die in Mexiko verbrachten acht Jahre in guter Erinnerung, auch in privater Hinsicht. Dort habe ich meine Frau kennengelernt, zahlreiche feste Freundschaften geschlossen und hoch motivierte Schüler gehabt, die später zu angesehenen Professoren wurden. Dennoch verblieb mir immer noch eine gewisse Sehnsucht nach dem alten Europa, sprich Deutschland. Als ich einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie an der Universität Bielefeld erhielt, habe ich ihn nach reiflicher Überlegung angenommen. 1984 siedelten meine Frau und ich aus dem sonnigen Mexiko ins nebelige Bielefeld um. Auch hier empfing mich eine sehr anregende, aufgeschlossene Forschungsatmosphäre. Ich stellte fest, dass der ansonsten nur als Floskel verwendete Terminus „Interdisziplinarität“ an der Universität Bielefeld alltägliche Wirklichkeit war. Insbesondere nahm ich an einigen gemeinsamen Vorhaben mit Kollegen der Wissenschaftssoziologie und der Wissenschaftsgeschichte im „Schwerpunkt Wissenschaftsforschung“ teil.
Aber es kam endlich auch der Augenblick, die ostwestfälische Insel auf meiner Odyssee zu verlassen. 1988 nahm ich einen Ruf an die Freie Universität Berlin an. Nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten haben wir uns in Berlin sehr gut eingelebt. Eines Novemberabends des Wunderjahres 1989 standen meine Frau und ich an der Berliner Mauer und sahen das Wunder geschehen. Damals haben wir uns – wie alle anderen, die da waren – unheimlich gefreut. Was ich damals noch nicht wissen konnte, war, dass dieses Wunder auf die Dauer die langsame Agonie der FU Berlin, und insbesondere seines philosophischen Instituts, bedeuten könnte. Als diese Bedrohung immer spürbarer wurde, habe ich den Ruf als Nachfolger Stegmüllers an der LMU erhalten – und angenommen. Der entscheidende Grund für meinen Entschluss pro München war allerdings, dass keine andere der mir bekannten philosophischen Fakultäten in Deutschland, oder sogar in Europa, eine so starke Tradition und ein so starkes Profil auf den Gebieten hat, auf denen ich mich besonders zu Hause fühle – in der Logik, in der Philosophie der Mathematik, in der Wissenschaftstheorie, und überhaupt in der formal arbeitenden Philosophie.
Seit 1993 bin ich Vorsitzender des Seminars (zeitweise Instituts) für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie in der Philosophischen Fakultät der Universität München. Abgesehen von einem Forschungsjahr 2003/04 als Inhaber des Lehrstuhls „Blaise Pascal“ an der Pariser „Ecole Normale Supérieure“ (wo ich endlich die Zeit hatte, eine Geschichte der Wissenschaftstheorie zu schreiben, die vor kurzem in französischer Sprache erschienen ist), habe ich seit nunmehr 13 Jahren fast ununterbrochen in München gelebt und an der LMU gelehrt und geforscht. An keinem anderen Ort bin ich in meinem bisherigen Leben so lange geblieben. Und somit bin ich also nicht nur Philosoph, sondern auch Münchner Philosoph geworden, was ich als eine besondere Auszeichnung empfinde. Die Tatsache, dass ich inzwischen auch in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden bin, stellt eine zusätzliche Auszeichung dar, die die erste noch verstärkt, und die mich gegenüber der Bayerischen Wissenschaftswelt besonders verpflichtet.
Und so gelangen wir, liebe LeserInnen, zum Ende meiner Odyssee. Es sieht so aus, als ob München tatsächlich mein Ithaka darstellt. Wo könnte es sonst noch sein? Gewiss, wir leben nicht in rosigen Zeiten. Das gilt aber überall und für alle Bereiche. Die Zeiten sind schlecht für die universitäre Forschung, sie sind besonders schlecht für die geisteswissenschaftliche Forschung, noch schlechter für die philosophische Forschung, und ein Grad noch schlechter für die spezifisch wissenschaftstheoretische Forschung. Und dennoch werden in der Münchner Philosophie und Wissenschaftstheorie nach wie vor Arbeiten der höchsten, international konkurrenzfähigen Qualität geleistet; wir ziehen hochmotivierte Studierenden an, auch viele aus dem Ausland, die sehr oft glänzende Abschlussarbeiten schreiben, und werden Monat für Monat von hochkarätigen Gastprofessoren aus aller Welt besucht. Ich meine, wir stehen gar nicht so schlecht da. Jedoch mindestens eine Sache brauchen wir Münchner Philosophen noch, um nicht entmutigt zu werden: Nach den letzten Jahren der unerbittlichen Stellenkürzungen, Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen, aufgezwungenen Reformpläne, die sogleich wieder obsolet werden, und anderem mehr, brauchen wir endlich gesicherte Verhältnisse und ein wenig Ruhe, um uns unseren eigentlichen Aufgaben in Forschung und Lehre voll widmen zu können. Mögen die „höheren Instanzen“ einsehen, dass gute Philosophie keinen entbehrlichen Luxus darstellt, und Erbarmen mit uns zeigen …